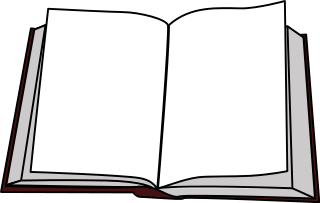
Info
München, 1987 | 130 Seiten | vergriffen
ISBN
Die Jobs der EliteEine marxistische Berufsberatung
Was soll ich werden? Diese Frage begleitet die im demokratischen Schulwesen einigermaßen vorangekommene Jugend, bis sie es schließlich geworden ist: was besseres. Dabei fällt auf, dass diese Antwort auf eine Lebensfrage gar nicht in der Macht derer liegt, die sie sich stellen müssen. Junge Leute können bloß die geforderten Bedingungen an sich herstellen, um ihr Leben nicht als Tippse, Wurstverkäufer oder Bergmann verbringen zu müssen. Ob sie mit ihren erworbenen Begabungen gebraucht werden auf den besseren Posten, die sie anstreben, steht ebenso wenig in ihrer Entscheidung wie das, was sie dort gegebenenfalls zu erledigen haben. Letzteres steht so unabhängig vom Sinnen und Trachten der Individuen fest, dass unsere aufgeklärte Gesellschaft mit aller gebotenen Skepsis dem Aberglauben anhängt, zum Oberamtmann, Kinderarzt oder Burgschauspieler und vor allem zum Regieren müsste der Mensch letztlich geboren sein – so als würden die Gene im Zellkern mit gewissen „umweltbedingten“ Vorbehalten den Errungenschaften der „zweiten Natur“, die sich ein jeder als gesellschaftliches Wesen notgedrungen aneignet, die Hand reichen. Und dieser Fetisch der „Begabung“ „erklärt“ gleich auch noch, zusammen mit „sozialer Benachteiligung“, die Ergebnisse der Konkurrenz um bessere Posten, die aus dem strebsamen Nachwuchs die nicht Gebrauchten aussortiert und, zynisch genug, mit dem Stempel versieht, damit hätten die ihre Unbrauchbarkeit unter Beweis gestellt.
„Was Besseres“ werden zu wollen und dann womöglich auch zu sein, ist also nur einerseits ein frei gewähltes „Schicksal“ – im Unterschied nämlich zur Karriere als normaler Lohnarbeiter, in die die Masse der Leute ohne überflüssige Inanspruchnahme ihrer Entscheidungsfreiheit hineingelangt. Wozu der bessere Mensch sich entscheidet und worum er sich ohne Zwang bemüht, ist ein Dasein als Charaktermaske gesellschaftlicher Positionen, von denen das selbstbewusste Individuum kein Jota erfunden hat und denen es außer einem – ebenfalls ziemlich gleichförmigen – höchstpersönlichen Selbstbewusstsein weiter keinen besonderen Stempel aufdrückt. Vortreffliche Persönlichkeiten, die sich hier um Unverwechselbarkeit bemühen, bringen es im besten Fall zu einem lächerlichen Effekt, über den keiner lacht: Sie subsumieren sich selbst nach Strich und Faden unter ihre hohe Aufgabe.
Worin die besteht, möchte eigentlich niemand so genau wissen. Zu Recht; denn das muss den Glauben stören, als Doktor, Börsenspekulant oder Zeitungsschreiber zur besseren Gesellschaft zu gehören, weil man selber „was Besseres“ ist und gerechterweise auch geworden ist. Andererseits kommt nicht einmal dieser Glaube von Natur; auch Akademiker müssen nicht ihrem eigenen Metier gegenüber ignorant bleiben. Geradeso gut wie Müllkutscher oder Köchinnen sind sie in der Lage, sich klarzumachen, was sie tun, wenn sie „was Besseres“ werden wollen und am Ende womöglich sind.
Ein paar Hilfestellungen dazu leistet die vorliegende Sammlung von berufsabratenden Artikeln, denen zwei einführende Berufsbilder allgemeinerer Natur vorangestellt sind.
Inhaltsverzeichnis
Die Jobs der Elite
Eine marxistische Berufsberatung
Was soll ich werden? Diese Frage begleitet die im demokratischen Schulwesen einigermaßen vorangekommene Jugend, bis sie es schließlich geworden ist: was besseres. Dabei fällt auf, dass diese Antwort auf eine Lebensfrage gar nicht in der Macht derer liegt, die sie sich stellen müssen. Junge Leute können bloß die geforderten Bedingungen an sich herstellen, um ihr Leben nicht als Tippse, Wurstverkäufer oder Bergmann verbringen zu müssen. Ob sie mit ihren erworbenen Begabungen gebraucht werden auf den besseren Posten, die sie anstreben, steht ebenso wenig in ihrer Entscheidung wie das, was sie dort gegebenenfalls zu erledigen haben. Letzteres steht so unabhängig vom Sinnen und Trachten der Individuen fest, dass unsere aufgeklärte Gesellschaft mit aller gebotenen Skepsis dem Aberglauben anhängt, zum Oberamtmann, Kinderarzt oder Burgschauspieler und vor allem zum Regieren müsste der Mensch letztlich geboren sein – so als würden die Gene im Zellkern mit gewissen „umweltbedingten“ Vorbehalten den Errungenschaften der „zweiten Natur“, die sich ein jeder als gesellschaftliches Wesen notgedrungen aneignet, die Hand reichen. Und dieser Fetisch der „Begabung“ „erklärt“ gleich auch noch, zusammen mit „sozialer Benachteiligung“, die Ergebnisse der Konkurrenz um bessere Posten, die aus dem strebsamen Nachwuchs die nicht Gebrauchten aussortiert und, zynisch genug, mit dem Stempel versieht, damit hätten die ihre Unbrauchbarkeit unter Beweis gestellt.
„Was Besseres“ werden zu wollen und dann womöglich auch zu sein, ist also nur einerseits ein frei gewähltes „Schicksal“ – im Unterschied nämlich zur Karriere als normaler Lohnarbeiter, in die die Masse der Leute ohne überflüssige Inanspruchnahme ihrer Entscheidungsfreiheit hineingelangt. Wozu der bessere Mensch sich entscheidet und worum er sich ohne Zwang bemüht, ist ein Dasein als Charaktermaske gesellschaftlicher Positionen, von denen das selbstbewusste Individuum kein Jota erfunden hat und denen es außer einem – ebenfalls ziemlich gleichförmigen – höchstpersönlichen Selbstbewusstsein weiter keinen besonderen Stempel aufdrückt. Vortreffliche Persönlichkeiten, die sich hier um Unverwechselbarkeit bemühen, bringen es im besten Fall zu einem lächerlichen Effekt, über den keiner lacht: Sie subsumieren sich selbst nach Strich und Faden unter ihre hohe Aufgabe.
Worin die besteht, möchte eigentlich niemand so genau wissen. Zu Recht; denn das muss den Glauben stören, als Doktor, Börsenspekulant oder Zeitungsschreiber zur besseren Gesellschaft zu gehören, weil man selber „was Besseres“ ist und gerechterweise auch geworden ist. Andererseits kommt nicht einmal dieser Glaube von Natur; auch Akademiker müssen nicht ihrem eigenen Metier gegenüber ignorant bleiben. Geradeso gut wie Müllkutscher oder Köchinnen sind sie in der Lage, sich klarzumachen, was sie tun, wenn sie „was Besseres“ werden wollen und am Ende womöglich sind.
Ein paar Hilfestellungen dazu leistet die vorliegende Sammlung von berufsabratenden Artikeln, denen zwei einführende Berufsbilder allgemeinerer Natur vorangestellt sind.
Beruf: Elite
Verantwortung und Leistung – diese beiden Gütesiegel der Elite zeichnen die Masse in der Demokratie wirklich nicht aus. Zur Verantwortung fehlt den meisten die Macht, bei den Leistungen hapert es an Zeit und Geld. Gewöhnlich ist die breite Masse damit zugange, sich das Nötigste zu verdienen, so dass ihr schon von daher die Bereitschaft fehlt, sich Verdienste zu erwerben. Massenmenschen gründen keine Republik, schreiben keine Verfassung, verpassen die Gelegenheit, Wirtschaftswunder aufzuziehen und Filialen zu eröffnen, entdecken im Leben kein Virus und keine Gesetzeslücke – es fehlt ihnen ganz einfach das Zeug dazu. Leistung kommt bei ihnen höchstens in dem unmenschlichen, physikalischen, höherer Werte baren Sinn von Arbeit pro Zeit vor – und das ist noch nicht einmal sicher. Unselbständig, wie sie sind, brauchen sie auch dafür noch Arbeitgeber und Konjunkturpolitiker, die ihnen Arbeitsplätze beschaffen. Für die richtigen Gedanken in ihrer freien Zeit und bei der Kinderaufzucht müssen ihnen Denker zur Verfügung stehen, die sie Mores lehren. Beim Streiten müssen ihnen Anwälte helfen, damit was Rechtes daraus wird. Und ohne Fachleute wüssten sie nicht einmal, ob das, was ihnen wehtut, eine Krankheit ist.
Ist es da verwunderlich, wenn verantwortliche Hochleistungsdemokraten sich und ihresgleichen für ein Menschenrecht und Lebensmittel der Massen halten, die ohne solchen Service gar nicht zu existieren wüssten? „Wer seinem Volk Leistungseliten verweigert, der verweigert seiner Jugend und den alten Menschen einen gesicherten Lebensabend.“ – So ein Mitglied der Elite, von deren Entscheidungen noch weit mehr abhängt als die Unsicherheiten des Lebensabends. Eine kleine Theorie der Weltwirtschaft, die jeder demokratische Verantwortungsträger genauso gut aufsagen kann wie Minister Genscher, macht auf die noch viel tiefergehenden Zusammenhänge aufmerksam: „Wer wie wir kaum über Rohstoffe oder andere natürliche Ressourcen verfügt, muss am Weltmarkt konkurrenzfähig bleiben, um zu überleben und zu prosperieren.“ Mit seinem Selbstmitleid einer rohstoffarmen Republik leitet der Stellvertreter zweier Kanzler den schönen Gedanken vom Rohstoff Mensch ein, der den benachteiligten Bergbau ersetzen muss – und ersetzen kann, sofern ein Teil davon zu Elite veredelt wird: „Unsere natürliche Ressource sind die Menschen, ihre Bildung und Ausbildung, ihre Leistungsfähigkeit und ihr Leistungswille. Daher kann unsere Gesellschaft, gerade wegen ihrer außerordentlich engen Verflechtung mit der internationalen Umwelt, nicht auf eine demokratische Leistungselite verzichten.“
Einen wohlmeinenden Patrioten, der von seiner nationalen Führung ernsthaft intellektuelle Kompetenz erwartet, weil davon Wohl und Wehe des Vaterlandes abhingen, müsste bei solchen Spruchweisheiten, aus denen das gesamte Zukunftsgeschwafel der regierenden Elite zusammengesetzt ist, das kalte Grausen ankommen. Der Vizekanzler führt das Fehlen sämtlicher Voraussetzungen korrekten Denkens vor. Er dokumentiert Gedächtnisschwund, wenn er öffentlich vergisst, dass er weltweit ein zwar rohstoffarmes, aber keineswegs armes Land vertritt, und zwar gegen viele andere Nationen, die zwar an Rohstoffen, deswegen aber noch lange nicht reich sind. Ihm versagt glatt die Wahrnehmung des offenkundigen Unterschieds zwischen einer Erzgrube und dem Geld, das Geschäftsleute in den Freiheitsoasen der NATO aus dem geförderten Zeug machen. Statt dessen will er beobachtet haben, dass die anderen viel Zeug in der Landschaft, „wir“ hingegen bloß Leute zur Verfügung haben. Und daraus zieht er einen Schluss, der seinem Urteilsvermögen kein gutes Zeugnis ausstellt. Wieso müssen „daher“ ein paar extra gute Leute mit hervorragenden Eigenschaften und ganz viel gutem Willen her? Bei aller internationalen „Verflechtung“: Ersetzt denn ein Ingenieur eine Zinngrube? Ist eine fachmännische Devisenspekulation das bundesdeutsche Äquivalent eines Goldbergwerks, das es hierzulande nicht gibt? Brauchen andere Nationen mit viel Erz im Boden keine „Konkurrenzfähigkeit“? Nicht einmal auf Genschers abstraktes Vorstellungsvermögen ist Verlass: Der Lobredner der Leistungselite lässt jede Kenntnis von dem Reichtum der Nation vermissen, um dessen „Konkurrenzfähigkeit“ es ihm unübersehbar zu tun ist. Den schaffen nämlich weder Politiker noch Journalisten und noch nicht einmal die leibhaftigen Erfinder von Mikrochips, Alltemperaturwaschmitteln und Plutoniumkraftwerken: Ob deren Einfälle zu Kapital werden, ist noch allemal eine Frage von tatkräftig angewandter Arbeit. Das Personal, das dafür Sorge trägt, hat mit der großen Masse hinwiederum ganz anders zu tun als in der unschuldigen Weise, dass es dank hervorragender Begabung aus dieser ausgesucht wäre – für Elitemenschen: dies der Wortsinn von „Elite“ – und nun durch eigene Arbeit glänzen würde.
Die gedanklichen Leistungen des Ministers erfüllen den Tatbestand des Schwachsinns – aber wer achtet schon bei einem renommierten, über Jahre erfolgreichen Außenminister auf die Stichhaltigkeit seiner „weil“s und „daher“s. Elite bedeutet doch gerade nicht, dass das Publikum die Worte derer, die anerkanntermaßen das Sagen haben, auf die Goldwaage legt. Menschen, die in der Demokratie zu Hause sind, kennen und verfügen über den selbstbewussten Respekt, den ihre Auserwählten verdienen. Deswegen wissen sie bei den Verlautbarungen wichtiger Leute das Gemeinte zu würdigen, das ihnen ohnehin geläufig ist und das wirklich keine Argumente nötig hat, um zu gelten und seine Wirkung zu tun. Gemeint und mit Anspruch auf Beifall vorgetragen ist hier der an manchem gar nicht elitären Stammtisch der Nation als anerkannte Münze zirkulierende Gedanke, dass Elite sein muss, und zwar eine aus „Persönlichkeiten“ und mit „Führungsqualitäten“. Ernstlich „Wozu?“ zu fragen, verbietet sich hier von selbst, weil es bei dem „muss“ gar nicht um die tatsächlichen Leistungen der Besten und deren Notwendigkeit geht und auch nicht um die tatsächlichen Verfahren und Ergebnisse der Auslese, durch die die Ausgelesenen ermittelt werden. Wenn Führer und Geführte eine Elite fordern, damit in Fußball, Politik und Kunst die Persönlichkeiten nicht aussterben, die Erfolg verbürgen, dann bekennen sie sich zu einer ideologischen Deutung aller Gegensätze und Unterschiede, die sie kennen oder jemals kennenlernen in ihrer demokratischen Marktwirtschaft. Sie bekräftigen ein Verständnis für die demokratische Sortierung der Nationalmannschaft in Herr und Knecht – wie sie ohnehin täglich abläuft –, das ein bleibendes Einverständnis mit sämtlichen Klassengegensätzen, der beruflichen Hierarchie, der politischen Macht und den Härten des Konkurrierens sichert.
Der demokratische Elitegedanke wirft ausschließlich das eine, enorm konstruktive Problem auf: Ob das Personal für oben und unten, fürs Tragen von Verantwortung und den freien Gebrauch des großen Eigentums, auch richtig ausgesucht ist. Und diese Überlegung, ob es in der heutigen Gesellschaft auch jedermann an den richtigen Platz verschlägt und jeder Posten die richtige Besetzung findet, ist unabhängig von der Antwort, die einem einfällt – „ja“, „nicht immer“, „selten“, „nie“ –, eine Parteinahme für eine gesellschaftliche „Ordnung“, in der es „nun einmal“ oben und unten gibt und geben muss.
Die affirmativen Zweifel und Bedenklichkeiten in Sachen Elite, die den demokratischen Geist beschäftigen, besitzen eine Berufungsinstanz und haben einen Grund. In die Welt gekommen sind sie durch den Materialismus des Kapitals, das überhaupt nichts von überkommenen gottgewollten und anderen Ordnungen hält. Ihm geht es um die Mobilisierung jeder greifbaren natürlichen und menschlichen „Ressource“; also findet ein fortwährender Test auf die Brauchbarkeit der Menschenkinder statt, deren Inhalt und Kriterien dauernder Veränderung unterliegen. Das Verfahren heißt Konkurrenz. Der diktiert die Staatsgewalt die „Spielregeln“, welche bei der Begutachtung der großen und kleinen Persönlichkeiten und ihrer nützlichen Eigenschaften kein „Ansehen der Person“ zulassen. Dieser zweckmäßigen Einrichtung entnehmen die Betroffenen wie die Aufsichtsbefugten, und vor allem die berufenen Sinndeuter, die Gewissheit, dass „eigentlich“ niemand von einem gesellschaftlichen Los betroffen sein darf, das ihm nicht gerecht wird. Und folglich wälzen sie immerfort das Rätsel, ob das jeweils stattfindende Schicksal auch wirklich verdient sei. Das engagierte Problematisieren zahlloser „Einzelfälle“, in Welche sich die kapitalistischen Lebensverhältnisse da ideologisch auflösen, lebt heute wie in den ersten Tagen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit von dem Schwindel, die Stellung des Menschen in der bürgerlichen Stufenleiter von Lohn und Leistung, Befugnis und Vermögen, und mithin diese Hierarchie selbst hätte ihren wahren, eigentlichen und letzten guten Grund in dem, was einer so an sich hat und an „Substanz“ beischleppt. Die freiheitlichen Ideale der Konkurrenz begründen so den selbstverständlichsten, von jeder Juden- und Negerfrage gereinigten demokratischen Rassismus – übrigens kommen Neger, Juden, Kommunisten und andere Versager durchaus auch in diesem „System“ wieder zu ihrem natürlichen Recht auf eine gewisse Sonderbehandlung, ebenso wie der nur einerseits entthronte liebe Gott, der andererseits nach Auffassung einer kopfstarken Elite für die BRD ausgerechnet diese Marktwirtschaft vorgesehen hat.
Derlei Akzentsetzungen fallen aber bereits in den Bereich jener konjunkturellen Abwandlungen, die der Glaube an die Menschennatürlichkeit der kapitalistisch funktionalen, demokratisch betreuten Menschensortierung gerade wegen seiner unbezweifelbaren Brauchbarkeit immer wieder erfährt. Die Weisheit „Jeder Arsch an seinem Ort; suchst du ihn, so ist er dort!“ ist wohlmeinenden Menschen auch schon einmal geeignet erschienen, unter dem Titel „Chancengleichheit“ in eine erst noch zu verwirklichende Forderung umgemünzt zu werden. Die Bedingungen der Chancenverwertung zu ändern, galt da als hohes Ziel. Und die Sortierung, die daraus wie durch ein Wunder nach wie vor hervorging, wurde für gerechter befunden. Wohl deshalb, weil sich anschließend – wie schon vorher – ein paar Minister damit brüsten konnten, garantiert einem Arbeiterhaushalt zu entstammen, womit sie fraglos ihre Berechtigung nachgewiesen hatten, andere zu deckeln. Zur Abwechslung entdecken ein paar Mitglieder der Elite dann auch wieder einmal die Gefahr, dass der Nachschub an so besonderen Erfolgstypen wie ihnen vor lauter „Gleichmacherei“ vollends zum Erliegen kommen könnte, und kämpfen mutig gegen ein „Tabu“, das es nur gibt, weil sie sich dagegen gewendet haben wollen: „Das Wort ‚Elite‘ darf dabei kein Tabu sein.“ Und um den Leistungsträger Genscher noch einmal mit seinem Vermögen zu logischen Schlussfolgerungen zu Wort kommen zu lassen: „Aber gleiche Chancen schaffen nicht gleiche Ergebnisse; deshalb gehört zu dieser Chancengleichheit dass die bessere Leistung ermöglicht, dass Begabung nicht vernachlässigt, sondern nach Kräften gefordert wird.“ Mit seinem verkehrten „deshalb“ tritt der Mann für eine Sache ein, die ohnehin dauernd geschieht: für die Ungleichbehandlung des Menschenmaterials der Nation, sobald die Konkurrenz den ersten ausnutzbaren Unterschied an den freien und gleichen Persönchen hervorgetrieben hat. Betont will er haben, dass das auch so sein muss, weil nämlich„die beste Staatsverfassung und Staatsform“ überhaupt „diejenige (ist), die mit natürlichster Sicherheit die besten Köpfe der Volksgemeinschaft zu führender Bedeutung und zu leitendem Einfluss bringt.“
Diese Formulierung stammt zwar nicht von Genscher. Aber dass sie zum gedanklichen Rüstzeug des letzten gesamtdeutschen Reichskanzlers gehört hat, belegt überhaupt nicht, dass in dieser staatsmännischen Sorge um gerechte Karrieren für Auserlesene ein Verstoß gegen die Demokratie vorläge. Hitler hat in schlichten Worten die skeptische Weltsicht ausgedrückt, die zum Selbstbewusstsein jeder modernen Elite gehört.
Und leider auch zum Selbstverständnis der weniger Ausgesuchten, die von ihrer Elite gedeckelt, an die Arbeit gestellt oder auch heimgeschickt, belehrt und bevormundet, regiert und unterhalten werden. Dass das Volk arbeitet, gehorcht und den Glauben teilt, seine Herren seien zum Führen irgendwie berufen – das, sonst nichts, sichert der Elite ihren Erfolg, der sie zu was Besserem macht und ihr ein gewisses Recht auf Prominenz verschafft.
Beruf: Student
Wer etwas werden will in unserer gleichheitlichen Gesellschaft, der muss sich bemühen und etwas lernen: studieren. Das fordert Einsatz. Wer sich darauf einlässt, dem können Studienprobleme nicht erspart bleiben. Die betreffen nicht bloß die Wohn- und Ernährungsfrage in den Semestermonaten. Sie betreffen den zu lernenden Stoff:
Was da Schwierigkeiten bereitet, ist in den geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern eines jedenfalls nicht: die vollständige Erklärung einer Sache, die systematisch nachvollzogen sein will. Die Probleme fangen mit dem Vorlesungsverzeichnis an. Das ist unübersichtlich und will gemeistert sein, ebenso wie die komplexe Hörsaalnummerierung – praktische Intelligenztests, die die nächstfolgenden Schwierigkeiten in passender Weise vorwegnehmen. Da gilt es nämlich herauszufinden und sich zu merken, Welche Einzelfächer zum gewählten Fachgebiet überhaupt dazugehören; und man muss damit klarkommen, dass schon die Systematik dieser Unterabteilungen von jedem zweiten bis dritten Dozenten anders gesehen wird. Hier hilft der Studienplan weiter, den inzwischen jede Universität für fast jedes Fach eingeführt hat; der übersetzt die Systematik des Faches in ein Nacheinander, das sich befolgen lässt. Andererseits erledigt sich damit noch lange nicht das Problem, angesichts der angebotenen Stoffülle einen Leitfaden dafür zu entdecken, was man sich merken muss und was man getrost gleich wieder vergessen darf. Was will aufgeschrieben sein? Für was ist der behandelte Stoff ein Beispiel? Oder kommt es auf die facts and figures selbst an? Eine harte Nuss für Studienanfänger!
Kommt Zeit, kommt Rat. Irgendwann kommen dem akademischen Lehrling die vorgetragenen Problemstellungen, Beispielsfälle und Grundkategorien unweigerlich bekannt vor. Er denkt schon mal „Aha!“ oder „Ach so!“. Und wenn ihm das ungefähr zehnmal passiert ist, dann – ist er kein Anfänger mehr.
Was hat er dann gelernt?
Er hat gemerkt, wie in seinem Fach wissenschaftliches Denken geht. Dass es da nämlich um eine besondere Kunst geht, Fragen zu stellen, auf die niemand so ohne weiteres gekommen wäre; tiefer schürfende Fragen jedenfalls als ein schlichtes: „Was ist los und warum?“ Er hat gemerkt, dass es nicht um die Beseitigung von Unklarheiten geht, sondern darum, ein Verhältnis der Unklarheit zu im Prinzip beliebigen Gegenständen zu eröffnen. Hierfür braucht es recht vertrackte Anweisungen, inwiefern etwas für ein Problem und für was für eins zu halten sein soll. Er lernt die Wissenschaft kennen als eine nur auf den ersten Blick ganz labyrinthartige Kunst der Verfremdung.
Diese Entdeckung wird erleichtert durch eine ganz unproblematische Vertrautheit mit den zu erlernenden Denkweisen, die sich einem durchschnittlichen Abiturienten genauso unweigerlich aufdrängt. Die zentrale ideologische Botschaft des jeweiligen Faches hat er nämlich immer irgendwie schon mal gehört; und wenn nicht, dann kommt es ihm auf alle Fälle zu Recht so vor.
Den Studenten der Ökonomie z. B. erinnern die vorgeschriebenen Grundkurse zuerst einmal ans scheinbar Allervertrauteste: Vom „Haushalt“ mit seinen Geldeinteilungsproblemen ist die Rede. Doch unversehens befindet er sich im Bereich mathematischer Funktionsgleichungen; Alltägliches wird nach Bedarf herangezogen oder zurückgewiesen, um der ersten und zweiten Ableitung der zu konstruierenden Kurven die zweckmäßige Gestalt zu geben, die die Wissenschaft für ein viel späteres Kapitel braucht, das immer noch gar nicht dran ist. Auf die Konstruktion von Modellen soll man sich einlassen, weil die Prämissen dafür da sind, und die Prämissen soll man annehmen und sich zurechtlegen, damit die Konstruktion von mathematischen Modellen sicher voranschreiten kann. – Doch mitten in diesem schwindelerregenden Geschäft streift den Studenten auf einmal die Ahnung, dass er den Zweck des Unternehmens bereits kennt. Die längsten und komplexesten Formeln geben nämlich Zeugnis von zwar fiktiven, aber sehr notwendig aussehenden zweckmäßigen Sachnotwendigkeiten in der Sphäre des materiellen gesellschaftlichen Lebensprozesses. In seiner Popularform ist der Glaube an eine solche Übersetzung von ,Interesse‘ in ,Sachzwang‘ einem jeden geläufig; z.B. als die gar nicht zur Beantwortung vorgesehene Frage: Wie soll’s denn sonst gehen?
Die Politikwissenschaft macht ihre Anfänger mit etwa zwei bis fünf Methoden bekannt, das vom politischen Geschehen und seinen Urhebern Bekannte zu verrätseln. Meist wird es zuallererst ganz ohne Argument als ein nicht enden wollendes Chaos ungewichteter Einzelfakten hingestellt, das quasi noch vor jeder Kenntnisnahme nach einem Ordnungsschema ruft, welches überhaupt erst einen politischen Inhalt stiften soll. Die elementarsten Unterscheidungen wollen als Ausgeburten einer methodischen Notwendigkeit des Ordnens überhaupt erschaffen sein, wozu beispielsweise ein Überblick über die Geschichte der politischen Ordnungsideen ratsam erscheinen kann oder auch über die Vielfalt ideell konkurrierender politischer Systeme. Ein Spiegel spiegelt sich im anderen. – Und dabei geht es überall um eine Botschaft von erhabener Plattheit: Zwangsgewalt ist nützlich; die Menschen brauchen das – welchem Hausmeister wäre dieser tiefsinnige Befund fremd?
Die Soziologie greift überhaupt alles Vertraute auf, aber so, dass es überhaupt nicht recht wiederzuerkennen ist. Es erfährt eine eigenartige Beleuchtung als Fall einer dahinter liegenden Gesetzlichkeit, die weiter gar keinen anderen Inhalt haben soll als den eine Gesetzlichkeit zu sein; diese Abstraktion macht selbst modernen Studienanfängern schwer zu schaffen. Oberabstrakte Formbestimmungen wie „System“, „Umweltkomplexität“, „Funktionalität“ und dergl. Zeichnen in dieser fremdartigen Welt für alles Wirtschaftsgeschehen ebenso verantwortlich wie für die Höflichkeit zwischen den Menschen. – Und doch: Der Glaube an eine Hinterwelt unentrinnbarer Zweckmäßigkeit hat den Reiz eines alten Bekannten. Dass der Gang der Dinge schon seinen Sinn haben wird, auch und gerade wenn die ihm Unterworfenen ihn weder praktisch beherrschen noch überhaupt kennen, dass also Strukturen walten – das ist doch eine gar nicht so problematische Säkularisierung des lieben Gottes, wie ihn jeder kennt.
Die Psychologie versetzt ihre wissbegierigen Studenten gerne in ein kahles ideelles oder sogar wirkliches Messlabor, in welchem alles Treiben der Leute als Äußerung eines jeweils zugrundeliegenden Leistungsvermögens oder als Resultat von dessen Beeinträchtigung verständlich und/oder berechenbar gemacht wird, wobei je nach Dozent mal das Rechnen, mal das Verstehst-mich den Vorrang bekommt. An Würmern, dressierten Affen, dem Augapfel und erst im Oberseminar an Psychokisten der lebendigeren Art denkt man sich in eine Hinterwelt determinierender Seelenkräfte hinein. Wenig davon hat man jemals erlebt. – Aber andererseits: Das Prinzip des Ganzen ist Leuten nicht fremd, die längst praktisch gelernt haben, sich selbst als mehr oder weniger taugliches Mittel in verschiedenen Konkurrenzkämpfen einzusetzen, also auch so zu interpretieren.
In der Germanistik und verwandten Fächern werden in genussvoll umständlicher Manier allerlei philosophische Botschaften -mal die vom Dichter anderweitig platt genug ausgedrückten, meist aber noch viel vertracktere – ausgerechnet aus den Formen der Kunstwerke herausgezerrt, die doch – denkt man, aber zu Unrecht – „bloß“ auf Genuss abzielen und nicht gerade auf Tiefsinn. Selbst den skeptischen Studienanfänger dünkt es kühn, wenn seine Disziplin ganze Weltanschauungen einschließlich gesellschaftlicher Verhältnisse und Dichterbiographie in der Nussschale eines Gedichtleins auftut; und er muss sich fragen: Kann ich das jemals auch? – Aber andererseits: Was sollte ihn hindern? Das Prinzip des Interpretierens: der Standpunkt, dass um nichts so lustvoll und erbittert moralisch zu streiten ist wie um den Geschmack und dass Genuss erst durch den Schein von Sachkunde ehrenwert wird begleitet junge Bürger schon durch ihr vorakademisches Privatleben.
Ihrer ideologischen Quintessenz nach sind die fachspezifischen Fragestellungen also allesamt aus dem bürgerlichen Vorrat an unschwierigen Lebensweisheiten geschöpft; aus dem Gelulle des staatsbürgerlichen Moralismus wird der Student nicht aufgescheucht, wenn er lernt – er wird darin versichert. Auf dieser festen Basis werden Rezepturen für das Aufwerfen von Problemen geboten, die ohne solche Methoden niemand hätte. Deren Aneignung geht nur darüber, dass man sie befolgt – nie so, dass man sie durchschaut; dann ließe man’s nämlich.
Am besten wird dieses Denkmuster übrigens von einem von vornherein unwissenschaftlichen Massenfach erfüllt, das als eigene Disziplin in den Kosmos der modernen Geistes- und Gesellschaftswissenschaften geraten ist: Die Jurisprudenz sortiert messerscharf alles und jedes anhand der Gesetze und Urteilssammlungen, die dem Studienanfänger zunächst einmal viel zu Staunen geben – so geläufig ein gesundes Rechtsempfinden ihm andererseits ist. Statt einer wissenschaftlichen Methode sind es da Rechtspraxis und Kommentare, die das Tun und Lassen der Menschen insgesamt in ein eigentümliches Licht rücken, nämlich das des staatlichen Gewaltmonopols, das die juristischen Fragen aufwirft. Diese Fragen sind erstens zu lernen, und zwar so, wie es bei dieser Art „Probleme“ einzig geht, nämlich auswendig; deswegen sind sie zweitens noch eigens zur gewohnheitsmäßigen Beurteilungsweise zu „verinnerlichen“.
Ungefähr genauso müssen die Studenten in den anderen geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern zu Werke gehen. Ihr Lernen hat notwendigerweise sehr viel mit Gewöhnung zu tun und läuft nicht zufällig über die geradezu vokabelmäßige Einübung des fachspezifischen Fremdwörter- bzw. Formelschatzes. Irgendwann wagen sie es und nehmen so schwierige Worte wie „soziopsychologische Redundanz“, „psychophysischer Stereoeffekt“ oder „transzendentalparlamentarisches Konstruktivitätstheorem“ in den Mund; und wenn der Seminarleiter nickt, dann haben sie den nötigen positiven Verstärker weg. Dann werden immer mehr derartige Erkenntnisse in Referaten aufgeschrieben; auch die Kenntnis der Autoritäten des Faches sowie der Stichworte, die sie zum Problembildungsvermögen ihrer Disziplin beigetragen haben und über die sie zu Autoritäten geworden sind, schreitet unausweichlich fort. Der Student weiß endlich, wo’s lang geht in seinem Fach – und schon rücken Probleme neuer Art in den Blick.
Prüfungsängste bemächtigen sich des jungen Akademikers. Denn das lehrt jeder Seminarbesuch ja auch: Die aus Erfahrung gewonnene Unterscheidungsfähigkeit zwischen wichtigen Problemstellungen und vergessenswertem Beiwerk und ein entsprechend zweckmäßig eingerichtetes Gedächtnis sind nur Mittel zum Zweck. Es geht um Souveränität im Umgang mit den Fragestrategien des Faches sowie darum, diese mündlich, schriftlich und sowohl als auch darstellen zu können. Und zwar so, dass es die Dozenten überzeugt; davon nämlich, dass sich hier einer mit Verständnis und Anteilnahme in das Fach hineingelebt hat. Denn schließlich ist ja nicht das der Witz der Sache, sondern die Prüfung, von der jeder weiß, dass da ausgesiebt wird, ein Prozentsatz von Durchfallern also von vornherein feststeht. Dazu will keiner gehören; also wird es für alle unterschiedslos zur maßgeblichen Sorge, sich zu unterscheiden. So nimmt die Anstrengung ihren Anfang, mit Theorien und Autoritätenkenntnis, Problemstellerei wie aus eigener Werkstatt, Schlagfertigkeit und anderer Formulierungskunst – anzugeben.
Das fordert nicht mehr bloß Gedächtnis und Verstand, sondern den ganzen Mann resp. die gesamte Frau. Das Studium wird zur Imagepflege und zur Vorbereitung jenes guten Eindrucks, den man pünktlich machen muss. Genau in jenem alles entscheidenden Moment behält jedoch trotz aller Vorbereitung der Zufall sein Recht: die „Tagesform“ des Prüflings, der es mit dem Valium nicht übertreiben darf, vor allem aber die Laune des Prüfers, der seine Macht auszusortieren mit seiner Geneigtheit für die eine und gegen die andere Tour der Selbstdarstellung zu erfüllen pflegt. So werden Extra-Anstrengungen fällig, den Zufall zu berechnen. Informationen über die Prüfer werden wichtiger als das Lernen langer Skripte; sonst merkt man sich am Ende doch gerade das Falsche.
Vor allem aber will der seelische Eindruck bewältigt sein, den die gar nicht zu beseitigende Unsicherheit und Unberechenbarkeit der Prüfung auf den Kandidaten machen muss. Die Kritik der Prüfung und ihrer Irrationalität hilft da kaum weiter, da man sie ja bestehen will. So bleibt nur die Hinwendung zur Eigene Person, die sich durch unsichere Aussichten dauernd verunsichern lässt, und zwar ausgerechnet um so mehr, je mehr es auf sie als einziges Mittel des Prüfungserfolgs ankommt. Vielleicht muss zur Ergänzung der zusammengerafften Gelehrsamkeit ein autogenes Training her? Auf alle Fälle bedarf die Kunst der Angeberei noch einiger Ergänzungen. Der eine Kandidat wird aus lauter Berechnung weinerlich und nervt den Prüfer mit Entschuldigungen; die andere Kandidatin probiert es mit Arroganz, jedenfalls sofern sie weiß dass der Herr Professor auf forschen Weibern steht. Kurzum: Unter dem Druck der Prüfungsangst reift der Student zur Persönlichkeit mit Charakter.
Studenten der Naturwissenschaft brauchen bei dieser Bildungsveranstaltung, die den eigentlichen Unterschied zwischen die studierte und die nicht-studierte Menschheit legt, übrigens nicht abseits zu stehen, bloß weil ihr Stoff vernünftiger beschaffen ist als der der Geistesfächer. Schließlich müssen auch sie sich an Leistungsbeweisen sortieren also mit ihrem Wissen, obwohl es stimmt, den Zufall der ausgewählten Prüfungsfragen meistern und eine dadurch bestens begründete Angst bewältigen. So gewöhnen auch sie sich daran, ihr bisschen gutes Wissen als Mittel ihres Konkurrenzerfolgs und Qualitätsmerkmal ihrer akademischen Persönlichkeit zu handhaben und in die Künste der Selbstproblematisierung und -ermunterung einzuwickeln.
Der Lohn der Angst stellt sich mit bestandener Prüfung zwar erst zur Hälfte ein; aber schon die ist nicht ohne.
Die psychischen Unkosten bekommt der Prüfling gleich zurückerstattet. Er besitzt ja nun ein offizielles Zertifikat über die Tauglichkeit seiner Person zu einer akademischen Karriere; sein Selbst und dessen Darstellung haben die Anerkennung gefunden, auf die es ankam. Die Unvernünftigkeit der Prozedur, durch die dieser Erfolg zustande kam. Stellt sich im Nachhinein gar nicht mehr furchterregend, sondern eher erheiternd dass. Jeder Studienabsolvent, erst recht jeder Doktor weiß nun aus eigener Anschauung, auf wieviele Zufälle sein „Bestanden!“ tatsächlich gegründet war; wie wenig es mit solider Fachkenntnis zu tun hatte; wie vielleicht sogar der Prüfer sich blamiert hat; keine Prüfung ohne die entsprechende Prüfungsanekdote.
Das beeinträchtigt aber überhaupt nicht die Hochachtung vor dem errungenen „Leistungsnachweis“. Im Gegenteil: Der Spott über die bestandene Prüfung, die vorher das Leben des Studenten verdüstert hat, zeugt von einem um so gediegeneren Stolz auf die eigene Person, die ja, das Zeugnis beweist es, die entscheidende Klippe, an der viele scheitern, bewältigt hat, und das sogar locker. Da macht es erst recht nichts, dass das mühselig genug angeeignete Prüfungswissen von Stund an zu vergessen ist: Auf wissenschaftliche Einsichten, die den Absolventen durch sein weiteres Leben begleiten würden, bezieht dessen Selbstzufriedenheit sich gar nicht. Dass er mit seiner Geistestätigkeit nach den Maßstäben des wissenschaftlichen Anerkennungsverfahrens richtig liegt und sich darin vom größeren Rest der Menschheit unterschieden wissen darf, das verleiht der angewöhnten Problematisierungskunst und der Angeberei damit fürs weitere Leben eine sichere Grundlage.
Der materielle Lohn bleibt hinter dieser seelischen Vergütung freilich zunächst einmal zurück; und damit ist auch wieder für Bescheidenheit gesorgt. Schließlich muss der fertige Akademiker in eine wirkliche lebenstüchtige Karriere erst noch hinein; auf die gibt die bestandene Prüfung nicht das kleinste Anrecht. Für die fällige Ernüchterung sorgt der Arbeitsmarkt, inzwischen ja sogar ein wenig unter fertigen Medizinern. Die gebildete Persönlichkeit ist gleich wieder als Konkurrenzmittel gefordert; Arbeitgeber bzw. Einstellungsbehörden wollen mit einem guten Eindruck betört sein. Der fertiggewordene Akademiker ist sonst eben noch nichts; er ist bloß abhängig von fremdem Interesse, und das demütigt ihn fast so wie jeden Lohnarbeiter oder Angestellten.
Aber eben nur fast. Denn immerhin liegen die Jobs, in die ein erfolgreicher Prüfling sich erst noch hineinschleimen muss, von vornherein auf der anderen Seite. Die Karriere, wenn sie denn losgeht, ist eine innerhalb der gesellschaftlichen Elite. Und was der studierte und geprüfte Mensch mitbringt, ist neben der festgesetzten Einstiegsbedingung die höchstpersönliche Eignung zur Charaktermaske dieses ausgezeichneten Standes.
Mit seiner Person steht er nämlich für die beiden Lebenslügen des demokratischen Rassismus ein:
- Erstens wären die besseren Leute, die sich an höheren Bedürfnissen messen als die gewöhnlichen und damit auch noch als deren Vorbild Anerkennung beanspruchen dürfen, nur deshalb Welche weil sie über das gesammelte Wissen der Gesellschaft verfügen und damit an die Spitze einer zweckrational durchorganisierten Gesellschaft gehören würden. Zwar sind die Akademiker eine einzige Widerlegung des Glaubens an eine rein funktionale Arbeitsteilung als herrschendes gesellschaftliches Unterscheidungs- und Ordnungsprinzip: Nach ihrem Wissen richten sich die maßgeblichen Interessen nicht, sondern umgekehrt; und wo es sich nicht zufällig um Naturerkenntnis handelt? Besteht es in einer Verstandestätigkeit der höchst seltsamen Art, die nur in einem sehr fatalen Sinn zweckmäßig ist: Sie ersetzt und zensiert das Interesse an richtigem Wissen in Sachen Gesellschaft und Politik. Eben deswegen lässt die Wissenschaft aber auch keine Kritik an ihr selbst und dem Akademikerstand zu, sondern tut alles für die Verwechslung von Amtsautorität und Sachkunde, Herrschaft und Arbeitsteilung, Wissen und Macht. Ihr Reich ist die contradictio in adjecto „geistige Führung“.
- Zweitens legen die studierten Leute mit der „zweiten Natur“, die sie sich beim Studieren zugelegt haben, Zeugnis ab für die Lüge, sie waren die besseren Leute, weil nur solche wie sie sich überhaupt dafür eignen würden, durchzublicken und was Besseres zu sein. Auch das ist nur in einem ziemlich vernichtenden Sinne wahr: Akademische Prüfungen hinter sich zu bringen, in eine Karriere einzusteigen und darauf auch noch als eine Leistung stolz zu sein, de einen als Gesellschaftsmitglied der besseren Sorte auszeichnet, das verlangt einen gegen jedes bessere Wissen festgehaltenen Dünkel, der mit der Zeit jede Kenntnis der Eigene Person ersetzt. So gehören am Ende Posten und Charakter durchaus untrennbar zusammen – was gegen beide spricht. Nur zuallerletzt für die, die beides haben.
Beruf: Arzt
Das unendliche Geschäft des „Helfens und Heilens“ ist in der BRD der Traumberuf für Schrapphälse. Inzwischen : haben zwar die ,,Selbstheilungskräfte des Marktes“, in diesem Fall des freien akademischen Arbeitsmarktes, trotz strengem Numerus Clausus gegen zuviel Nachwuchs für die ,,drohende Gefahr“ einer ,,Ärzteschwemme“ gesorgt; mancher Jung-Mediziner könnte in Zukunft leer ausgehen. Noch immer gilt aber, nicht zu Unrecht, jeder Einser-Abiturient als Tor, wenn er nicht die NC-Bestimmungen ausnutzt und die den schlechteren Kameraden von vorneherein verschlossene Medizinerlaufbahn einschlägt.
Die herzlichen Beziehungen zwischen Geld und Medizin halten viele, sogar einige aus- oder noch nicht eingestiegene Ärzte, für einen Skandal. Am physischen Elend der Leute verdienen, mit dem unbezahlbar hohen Gut Gesundheit ein Geschäft machen – pfui Teufel! Dieser Vorwurf ist ungerecht. Womit machen denn ehrenwerte Industrielle hierzulande ihr Geschäft, wenn nicht auch mit der Gesundheit ihrer Lohnarbeiter und einiger Außenstehender noch dazu, die z. B. partout kein Blei vertragen ? Woran verdienen denn Deutschlands Banken, wenn nicht direkt oder indirekt an der Verarmung der Leute und einem gar nicht gesundheitsförderlichen Leistungsdruck auf sie? Und überhaupt: Seit wann zählt denn beim Geschäftemachen die moralische Qualität des gehandelten Gebrauchswerts? Mit vollem Recht ist das Gewissen der Ärzte so rein wie ihr Steuerberater beschäftigt. Dass mit ärztlicher Kunst und Wissenschaft ein dickes Privatgeschäft zu machen ist, liegt nicht an ihnen – eher schon das jeweilige Verhältnis zwischen beiden Seiten, über das wir aber auch nicht rechten wollen; das erledigen längst berufenere Moralisten und im Ernstfall die Gerichte.
Ärzte können – im großen und ganzen – nichts dafür, dass ihnen ihre Geschäftsbedingung, der Nachschub an Krankenmaterial, ‚nicht ausgeht. Es gibt zahllose Belastungen – und keine davon hat die Ärzteschaft zu verantworten –, denen der Mensch als ziemlich weiches und zerbrechliches Lebewesen nicht so recht gewachsen ist: Bazillen und Arbeit, Verkehrs- und Sportunfälle, Gift und Lärm … Es kommt hinzu, dass der Mensch als Individuum mit eigenem Willen und falschem Bewusstsein allemal schon sein besonderes, selten gesundes Bewältigungsverhältnis zu seinen Gebrechen eingerichtet hat, bevor er zum Arzt geht bzw. wenn er zu ihm gebracht wird. Meist ist es zu spät für eine richtige Heilung, manchmal aber auch viel zu früh, wenn der Patient lamentierend daherkommt.
Das alles macht dem guten Doktor das Leben schwer. Der flickt nämlich nicht bloß zusammen oder richtet mit Kunst und Chemie wieder her, was ihm an fertigen Schäden präsentiert wird. Dieses redliche Handwerk verrichtet er zwar auch, so gut er es eben versteht. Zum ärztlichen Berufsbild gehört aber allemal einige Verachtung des ,,bloßen Knochenflickers“, den es bei allem Medizinerzynismus daher gar nicht gibt. Der Dienst, den ein Arzt leisten will und den der Patient von ihm erwartet und – so gut er kann – fordert, umfasst durchaus eine Erkundung und ein Eingehen auf die Krankheitsursachen; in Form einer Krankheitsgeschichte, mit der gleich ein gutes Stück der individuellen Lebensführung aus der Vergangenheit und damit auch gleich für die Zukunft zur Debatte steht.
Es sind nämlich schon längst, im Grunde seit den ersten epochemachenden Erfolgen der modernen wissenschaftlichen Medizin, in erster Linie keine Unbilden der Natur mehr, deren Auswirkungen die Ärzte zu pflegen und nach Möglichkeit zu kurieren haben. Was sie in der Physis ihrer Patienten an Gebrechen vorfinden, sind hauptsächlich die Hinterlassenschaften höchst zivilisierter Einwirkungen und Anstrengungen, die zusammen eine ziemlich ungesunde Daseinsgestaltung ausgemacht haben. So ist ja sogar das massenhafte Bemühen um eine ,,natürliche Lebensweise“ aufgekommen, die ihrerseits I ihre Spuren hinterlässt, nicht bloß in Form von Knochenbrüchen auf der Skipiste. Regelmäßig führt die Anamnese zu der Erkenntnis, dass eine durchgreifende Verbesserung der Gesundheitslage des Patienten eigentlich weit mehr umfassen würde als alles, was sich in der Sprechstunde ausrichten und mit den chemischen Fitmachern erreichen lässt, die die pharmazeutische Kunst ausgetüftelt hat – nicht gerade ,,zum Wohle des leidenden Menschen“. Die populären Mittelchen, mit denen mancher Kunde ,,wiederhergestellt“ werden will, um gleich wieder für verlangte Dienste in Form zu sein, werden „nur ungern!“ verschrieben, nie ohne Vorladung zu einer ,,gründlicheren“ Therapie – die absehbarerweise erst stattfindet, wenn es mal wieder ganz ,,zu spät!“ ist. Ein gut betreuter Patient verlässt die ärztliche Praxis bzw. das Krankenhaus nie bloß mit Narben und Rezepten, sondern mit Kritik an seiner bisherigen und Ratschlägen für seine zukünftige Daseinsgestaltung. Allerdings auch in der stillschweigenden Übereinkunft mit seinem Doktor, dass sich so sehr viel nicht ändern wird. Denn das ist der Haken an der empfohlenen ,,gesünderen Lebensführung“, dass sie für den Durchschnittspatienten unpraktisch, hinderlich, zu teuer und mit den Notwendigkeiten des Geldverdienens kaum zu vereinbaren ist – schließlich hat der Mensch sich ja schon vorher nicht aus Jux allerlei Ungesundes angewöhnt.
Das Problem, das daraus folgt, ist eines des Patienten; es geht den Amt praktisch nichts an. Allerdings verrät e einiges über die wirkliche Zweckbestimmung seines Berufes. Nämlich dass die Gesundheit, um die das danach benannte ,,Wesen“ sich kümmert, keinen – geschweige denn selbstverständlichen – gesellschaftlichen Zweck darstellt, sondern immerzu gegen die selbstverständlichen Erfordernisse und Zwecke des gesellschaftliche Lebens zum Zweck gemacht werden muss – zum privaten Sonderzweck eben, der dann gar nicht mehr mit der herrschenden Benutzungsverhältnissen kollidiert, sondern mit den privaten Vergnügungen konkurriert. De Ärztestand, selber eine feste gesellschaftliche Einrichtung! , ändert an diesen Selbstverständlichkeiten nicht er ist ja auch nicht dafür da, die Belastungen zu kritisieren, die die betroffenen Mitmenschen unterschiedlich lange und mit unterschiedlicher Moral aushalten. Der ärztliche Dienst steigt ganz naturwissenschaftlich auf die physiologischen Ergebnisse ein und kritisiert darüber hinaus mit Ratschlägen und Pillen die individuelle Lebensgewohnheiten, zu denen sich die Patientenschar die herrschenden gesellschaftlichen Zwänge und Belastungen gemacht hat. Der Arzt ergänzt den gesellschaftlichen Verschleiß von Gesundheit, indem er den Wirkungen dort entgegensteuert, wo sie sich an den Individuen längst niedergeschlagen haben. Zu diesem Gegensteuern gehören Mahnungen und Rezepte nach dem Motto „Vorbeugen ist besser als Heilen“, die den gesellschaftlichen Verpflichtungen der Leute noch die Absurdität einer Pflicht gegen sich selbst hinzufügen.
So zählen die Ärzte von Berufs wegen zu den wichtigen gesellschaftlichen Autoritäten, obwohl sie – außer beim Krankschreiben – über gar kein Stück staatlicher Gewalt verfügen und weder Theologie noch Psychologie studiert haben. Dem Patienten gegenüber sind sie eine gewichtige moralische Instanz, und das keineswegs nur insofern, als ihre medizinische Fachkunde auf ein ziemlich ahnungsloses Publikum trifft, das an die Diagnose und Therapie glauben muss. Dem Patienten gegenüber treten sie als Anwalt seiner Gesundheit auf, die doch bloß deswegen den Rang eines verpflichtenden Lebenszwecks erhält, weil ihr Verbrauch zu den selbstverständlichen Lebensbedingungen eines werktätigen Gesellschaftsmitglieds gehört und weil die private Kompensation dieses Verschleißes einen Aufwand erfordert, der einiges an Einschränkungen fordert.
Glaubwürdig wie sonst keine moralische Instanz kann die Ärzteschaft für sich in Anspruch nehmen, sie wolle mit den von ihr vertretenen zusätzlichen Pflichten doch nur das Beste derer, die sich danach richten sollen. Dafür, den hierin enthaltenen Widerspruch zu bemerken, geschweige denn ihn aufzulösen, wird sie nicht bezahlt. Übrigens auch nicht aufgesucht. Patienten bleiben bei dem Arzt, dessen moralische Autorität sie schätzen; deswegen hat ja bekanntlich jeder Patient überhaupt den besten Arzt weit und breit.
Manche Ärzte, und vor allem die Funktionäre ihrer Standesorganisationen, die sonst ohnehin nichts zu tun haben, erstrecken diese berufsspezifische Autorität gerne über ihre Patientenschar und deren private Rauch-, Trink- und Essgewohnheiten hinaus auf ,,die gesellschaftlichen Verhältnisse“, die ja ohne große Schwierigkeiten als die wesentlichen „Krankmacher“ zu identifizieren sind. Das wird insoweit gern gesehen, wie die Mediziner in solchen allgemeiner gehaltenen Warnungen und Ratschlägen die Arbeit und die alltäglich konsumierten Gifte usw. als feste Lebensbedingungen voraussetzen, mit denen ein besserer Umgang, mit Diät und ohne Hetze und Schlafmittel, zu lernen sei. Praktisch einbezogen wird der Ärztestand darüber hinaus von Gesetzes wegen in die Gestaltung und das Management der Sphäre, in der die Gesundheit produktiv verschlissen wird – wo sie also in gehörigem Maß da sein und erhalten werden muss, um zweckdienlich verbraucht werden zu können. Die Arbeitsmedizin kümmert sich in diesem Sinne keineswegs bloß um Unfallopfer und fertige Krüppel, sondern um bandscheibengerechte Schreibschemel und MAK-Werte für Schadstoffe aller Art. Das schadet weder der 8-Stunden-Schicht am Schreibautomaten noch dem ökonomischen Umgang mit nützlichen Giften, sondern macht solche Eigenschaften menschenwürdig.
Problematisch wird es dagegen, wenn Mediziner sich für die völlige Beseitigung einer gesellschaftlichen Krankheits- und Todesursache wie etwa des Krieges einsetzen. Falls sie es nicht selber merken, werden sie von den regierenden Herren der Gesellschaft und deren Ideologen im Öffentlichkeitswesen darauf hingewiesen, dass ihre Autorität sich nur auf die Bewältigung der Schäden erstreckt, die die ,,Lebensrisiken der modernen Welt“ anderen Bewohnern hinterlassen, und dass alles andere eine Grenzüberschreitung aus politischer Voreingenommenheit und Kritiksucht darstellt. Standesbewusste Mediziner sehen das auch gleich ein, bleiben bei ihrem Leisten und gründen allenfalls ein „Rotes Kreuz“, das auch im Frieden alle Hände voll zu tun hat. Dieselbe Moral, die borniertes Helfen bis zum geht-nicht-mehr gebietet, gestattet Ärzten mit einem fortschrittlichen Selbstbewusstsein allerdings auch den interessanten Zweifel, ob das atomare Kriegsgeschehen überhaupt noch Raum und Gelegenheit lässt für eine hingebungsvolle Opferversorgung; diesen Zweifel machen die Aktiven unter ihnen als ihr standesspezifisches ,,Argument“ gegen den Atomkrieg geltend. Damit täuschen sie sich allerdings nicht bloß über den Krieg, der – genausowenig wie alle übrigen Einrichtungen der Klassengesellschaft – an der Bewältigung der Opfer, die er produziert, sein Maß findet. Sie täuschen sich auch über ihre eigentümliche Berufsautorität.
Diese beruht nämlich darauf, dass die Anwälte der Gesundheit sich nicht in die übrigen ehrenwerten Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und das Treiben der anderen ehrbaren Stände einmischen, sondern stur dem leidenden Individuum treu bleiben. Ihre physiologischen Kenntnisse haben dann moralisches Gewicht, wenn sie dazu dienen, die dicksten Hämmer unter den bornierten Gesichtspunkt zu subsumieren, dass da die Krankheitsgeschichte des einzelnen den einen oder anderen Fortschritt gemacht hat. Darauf haben die Ärzte mit ihren therapeutischen Bemühungen zu antworten. Deren Maßstab liegt nicht im nachzählbaren Erfolg – da müssten die Mediziner ja vor ihrer Sisyphos-Arbeit verzweifeln, und umgekehrt würde die tatsächliche Beseitigung zivilisierter Krankheitsgründe ihnen glatt ihre Kundschaft dezimieren. Ihre Antwort auf die gesundheitsschädlichen Wirkungen des ,,modernen Lebens“ orientiert sich ganz immanent an den Errungenschaften und Forderungen der ärztlichen Kunst und Wissenschaft bei der Reparatur geschädigter Individuen. Die Warnung vor dem Zigarettenrauchen ist durch die moralische Autorität des Ärztestandes voll gedeckt, weil er sich damit in die Lebensführung potentieller Patienten einmischt, die ihre Pflicht gegen die eigene Gesundheit vergessen; die Warnung vor dem Atomkrieg überschreitet ärztliche Kompetenz, weil sie die Arbeitsteilung zwischen Heilkunst und Staatskunst verletzt. Für die Aufforderung, privat und öffentlich Vorratslager an Jodtabletten und Brandschutzsalbe anzulegen, sind die Doktors dann wieder uneingeschränkt zuständig.
So geht die gesellschaftliche Arbeitsteilung für den Medizinerstand bestens auf und in Ordnung: Die Klassengesellschaft sorgt mit ihren verschiedenartigen, friedlichen wie unfriedlichen Ansprüchen ans Menschenmaterial nicht bloß für massenhaftes Krankengut, sondern auch dafür, dass Bazillen und Bandscheiben sich für jeden Betroffenen als sein privates Lebensführungsproblem darstellen; auf dieses und unter diesem Gesichtspunkt zeigt die ärztliche Kunst mit Skalpell, Chemie und moralischen Dummheiten sachgerecht ein, so dass das Ganze klappt und der gesellschaftliche Bedarf an verbrauchbarer Gesundheit ebenso auf seine Kosten kommt wie der „leidende Mensch“ in seinem „Unglück“.
Bleibt noch die Umständlichkeit, dem Ärztestand dazu zu verhelfen, dass auch er auf seine Kosten kommt und aus seinen Arbeitsbedingungen eine Geschäftsbedingung wird. Denn auch das gehört ja zu den Errungenschaften der .modernen Leistungsgesellschaft“, dass den gesundheitsschädlichen Belastungen, die sie als Privatproblem der Betroffenen organisiert, in der Masse der ,,Fälle“ gerade keine privaten Finanzmittel entsprechen, mit denen diese sich ärztlichen Beistand kaufen könnten. Ohne die Zwangskollektivierung einer der beiden Seiten, entweder der Ärzteschaft oder von ansehnlichen Lohnteilen, geht es da kaum ab. Als marktwirtschaftlicher Freiheitsstall hat die bundesdeutsche Demokratie sich für die letztere Variante entschieden und mit Geldern, die von der großen Masse ohne überschüssiges Geld – bis zur ,,Beitragsbemessungsgrenze“ hinauf – zwangsweise eingesammelt werden, ein Versorgungsnetz aufgezogen, das – zusammen mit der privat versicherten besseren Kundschaft – der Mehrheit der Ärzte den Status selbständiger Klein- bis Mittelunternehmer sichert. Deren Geschäft wird zwar erst durch die hemmungslosen Rechnungen für Privatpatienten so richtig fett; seine solide Grundlage hat es aber in der Zahl der Krankenscheine, die, relativ unabhängig von den tatsächlich dafür erbrachten Leistungen, einen Zugriff auf den vergesellschafteten Lohnteil gewähren, den die gesetzlichen Krankenkassen verwalten.
Diese Organisation der Gesundheitsversorgung als Unmasse privater Pfründen – die passenderweise durch eigene Makler weitervermittelt werden – bringt interessante Konflikte und Fronten mit sich, weil sie das Verhältnis zwischen medizinischem Aufwand und finanziellem Ertrag auf zwei getrennte Verhältnisse verteilt: Im Umgang des Arztes mit dem Patienten entscheidet sich sein Aufwand an Arbeit und Kosten, im Abrechnungsverkehr mit den Kassen sein Einkommen. Dem Patienten bringt das den fragwürdigen Vorteil, dass seine medizinischen Bedürfnisse ihr Maß nicht direkt an den Sparbeschlüssen des Sozialstaats finden, sondern an der Geschäftstüchtigkeit, was in diesem Fall heißt: am Patientendurchsatz ,,seines“ Arztes – mit dem man sich, schon im Interesse einer gelegentlichen Krankschreibung, nach Möglichkeit gut stellt. Der Sozialstaat brockt sich den zweideutigen Nachteil ein, dass er es nicht direkt bloß mit dem Gesundheitsbedarf seiner Massen zu tun bekommt, wenn er sparen will, sondern mit den Einkommensinteressen eines ehrenwerten Standes, gegen den er sich vor mancher Trickbetrügerei vorsehen muss.
Die Hauptlast tragen natürlich die Ärzte. Die müssen dem Staat gegenüber den Anwalt der Patienten markieren, ohne dass die ihnen ihren dauernden Kleinkrieg mit der Kasse danken. Dem Patienten müssen die übertriebene Ansprüche abgewöhnen, ohne dass die Kasse das extra honoriert. Und dann soll bei Diagnose und Therapie auch noch nichts schiefgehen …
Der Zahnarzt
Zahnärzte haben es auch nicht leicht. Da haben sie ihre Eignung zur kassenärztlichen Abrechnung nach allen Regeln des NC und der Studienordnung unter Beweis gestellt und verdienen sich mit Bohren und Brückenbasteln dumm und dämlich – und dann müssen sie sich von jedem dahergelaufenen Kostendämpfer oder sonst einem ‚Durchblicker‘ erstens vorwerfen lassen, dass sie den Hals nicht voll genug kriegen können. Zweitens werden sie schon zu Studienzeiten laufend mit der Unterstellung konfrontiert, dass sie – Hochschulstudium hin, Hochschulstudium her – eigentlich ‚bloß‘ Handwerker sind. Das stimmt zwar, ist aber trotzdem nervtötend. Besonders ärgerlich ist das Ganze, wenn die Kollegen Humanmediziner, bloß weil sie am menschlichen Körper ein paar Etagen tiefer oder höher handwerkeln, ewig mit ihrer Verantwortung für ,,Leben und Tod“ angeben können und man selber nur die ,,Sanierung kariöser Gebisse“ dagegensetzen kann. Gegen diese ehrenrührigen Anwürfe hilft nur: weiter Geld scheffeln, vielleicht nebenher ein bisschen Geige spielen und Interesse für Literatur zeigen oder gleich zum Surfen gehen.
P. S.: Der Apotheker
Zum Apotheker wird man gewöhnlich geboren. Die Berufung zum Pillenverkaufen ergibt sich meist wie von selbst aus der Tatsache, dass die Eltern eine Apotheke besitzen. Das staatlich garantierte Verkaufsmonopol für die vielfältigen und ordentliche Gewinnspannen einschließenden Produkte der Pharmaindustrie, deren Bezahlung durch die Zwangsbeiträge zu den Krankenkassen gesichert ist, und der durch die kapitalistische Benutzung des Volkskörpers ständig garantierte Bedarf der Leute an Arzneimitteln macht aus jeder Apotheke im Prinzip eine Goldgrube. Um ins blühende PharmaVerkaufs-Geschäft einsteigen zu können, muss allerdings eine kleine Hürde überwunden werden: das Pharmazie-Studium. Ein paar Jahre lang muss man schon so tun – die Prüfungsordnung schreibt es vor –, als müsste man später tatsächlich Acetylsalicylsäure zu Hause selber brauen, damit man per Staatsexamen legitimiert wird, Aspirin von der Firma Bayer zu beziehen, um es anschließend über den Ladentisch zu reichen und das Geld nachzuzählen. Unnötig ist das Auswendiglernen der chemischen Formeln nicht. So wird eben streng demokratisch und gerecht der Zugang zu einem hochdotierten Job in dieser Gesellschaft geregelt. Das unterscheidet ein Pharmazie-Studium nicht von jeder anderen akademischen Ausbildung. Auf den Schein, das Einkommen wäre auch in diesem Fall nur gerade so hoch wie die Qualifikation, haben freie Bürger ein unveräußerliches Recht.
Beruf: Börsenspekulant
Der Börsenspekulant hält sich für den schlauesten Hund von der Welt. Er braucht keine Fabrik, keine Bank und kein Handelskontor, sondern ist alles in einer Person: Ein Schwung Telefone, ein Zeigefinger, Stimmbänder, ein Taschenrechner genügen ihm, um riesige Umsätze innerhalb kürzester Zeit zu managen und dabei schöne Gewinne zu erzielen.
Er handelt mit Anrechtsscheinen auf (erst noch zu produzierenden) Mehrwert, und auch mit Anrechtsscheinen auf Anrechtsscheine; besonders stolz ist er, wenn es ihm gelingt, einen Handel von Anrechtsscheinen auf Anrechtsscheine auf Anrechtsscheine auszuhecken. Dafür muss er Welche finden, die dabei mitmachen.
Die machen mit, wie sonst auch, wenn sich nämlich im Preis dieser Anrechtsscheine Veränderungen ergeben. Denn nur so lassen sich Gewinne machen. Für den Fall, dass die Preise nach unten gehen, muss man auf Baisse spekulieren, wenn sie nach oben gehen, muss man auf Hausse spekulieren. Dabei stört den Börsenspekulanten nicht, dass das, worauf er spekuliert, er selber macht. Er muss nur dem, was er bewirkt, zuvorkommen. Dann sind die anderen reingefallen, weil sie auf der Wirkung sitzengeblieben sind, während er rechtzeitig abgesprungen ist.
Er hört das Gras wachsen. Mit Luchsaugen und Fledermausohren saust er zwischen seinesgleichen herum, um „Informationen“ aufzuschnappen. Die gehen im wesentlichen darüber, wer wem was gesagt und sich dabei gedacht hat, was der wohl dabei denkt, weswegen er sich denkt, dass der dann … Wie gesagt, der Spekulant hält sich für einen schlauen Hund. Er glaubt nichts und weiß alles: Vom letzten Gewinnausweis und der bevorstehenden Ernte über die politische Lage, was andere von der politischen Lage halten, über den Stand der Bohrungen vor der Küste von …, Gerüchte aus der Notenbank, darüber, wer diese Gerüchte ausgegeben hat, was der sich denkt, was man sich dabei denken soll, bis zur allgemeinen Stimmungslage an der Tokioter Börse listet er alles auf, wägt sorgfältig ab und zieht dann einen Schluss daraus, was die meisten wohl machen werden. Dann macht er mit oder auch etwas ganz anderes. Nicht selten macht er Spekulationsgeschäfte, die ganz besonders sicher sind, weil er sich unter der Hand aus erster Hand über Firmenkäufe und -verkäufe informieren lässt und über alles vorher Bescheid weiß, worauf er dann spekuliert. Das ist nicht erlaubt, weil es von Betrug kaum zu unterscheiden ist, und deswegen doppelt reizvoll. Er ist aber auch ein Gemütsmensch und riskiert mal was ins Blaue hinein bzw. Auf sein Gefühl hin. Dabei ist er vorsichtig, behauptet aber, da wäre er ganz waghalsig gewesen, was überhaupt die Seele vom Geschäft.
Manchmal gerät der Spekulant auch in Panik. Er hört von allen das kann nicht länger gutgehen, und er hat sich auch schon sowas gedacht. Besonders, wie die politischen Instanzen dastehen und was sie verlautbaren, gibt ihm schwer zu denken. Damit es ihn nicht ganz furchtbar reinreißt, entfernt er sich rechtzeitig aus dem Geschäft. Wenn genug der Auffassung sind, gibt es eine Panik und es passiert genau das, was sie befürchtet haben. Haufenweise werden Anrechtsscheine wertlos. Die Börse wird geschlossen, macht dann aber wieder auf.
Der Spekulant ist ein ziemlich dummer Hund. Er hat keine Ahnung, womit er eigentlich handelt. Die Dummheit ist berufsnotwendig, denn wenn er wüsste, dass die Grundlage seines Geschäfts die Mehrwertproduktion und der dafür gegebene Kredit ist, dass Gewinne sich nicht aus einem geschickten Einkaufstelefonat und einem noch geschickteren Verkaufstelefonat ergeben, dann würde er mit seiner Informationsauflistung und -abwägung furchtbar durcheinander kommen und alles verpatzen. Der alte Marx hat’s ihnen vorgemacht.
Der Spekulant bekommt seinen Teil vom weltweiten Mehrwert, weil er eine nützliche Aufgabe erfüllt. Indem er in aller Welt Kurse, Zinsen, Preise und Tendenzen vergleicht, ist er die Speerspitze der Kapitalbewegung, der Pfadfinder des Sphärenwechsels. Er ist der Schwanz, der mit dem Kredit wedelt. Das ist gerecht denn wie wüsste der sonst, wo er hin muss.
Beruf: Ingenieur
Höhere Techniker waren die Ingenieure schon immer. Seit die Zusammensetzung von „hoch“ und „Technik“ – „high tech“ – die beschränkte Phantasie der Politiker und ihrer öffentlichen Meinung erobert hat, dürfen die Angehörigen dieses Berufsstands sich endgültig als die Garanten der nationalen Zukunft vorkommen. Die sollte ja schon zu Helmut Schmidts Zeiten im Export von „Blaupausen“ liegen. Nachdem dieses etwas altertümliche Hilfsmittel des technischen Erfindungsgeistes durch Computerprogramme abgelöst worden ist, soll Deutschland vollends durch das „know how“ seiner Ingenieure satt werden.
Abzüglich solcher ideologischen Übertreibungen bleibt vom Ingenieurberuf eine begrenzte Funktion innerhalb der gesellschaftlichen Anwendung naturwissenschaftlichen Wissens übrig. Bei der Konstruktion von Gebäuden und Maschinen, elektronischem Gerät und chemischen Kunststoffen müssen diese Leute wissen, worauf es jeweils ankommt, was ohne Erkenntnisse über die Natur der benutzten Stoffe und Prozesse, Wirkungen und Ursachen nicht geht; sie müssen ihr technisches Personal mit den nötigen Berechnungen, Versuchen, Konstruktionen usw. Beauftragen können oder auch die Ergebnisse überwachen, so dass das Produkt zweckmäßig funktionieren kann. Manchmal ist sogar Phantasie vonnöten, damit etwas Zweckdienliches herauskommt. Meistens reichen Sitzfleisch und Routine, damit der Laden läuft. Sehr solide das alles und im Grunde sehr ehrenwert – fragt sich nur: Was machen Ingenieure berufsmäßig falsch, so dass ausgerechnet sie und ihre Werke in den berechnenden Ideologien nationaler Machthaber einen so hervorragenden Platz einnehmen?
Die Ingenieurskunst setzt Auftraggeber und Nutznießer voraus, von denen im modernen Lobpreis von „high tech“ und Erfindergeist nicht die Rede ist: Auftraggeber mit materiellen Mitteln, die auch die Ergebnisse materiell zu nutzen, in Reichtum zu verwandeln vermögen; denn Sachverstand alleine ist weder Reichtum noch schafft er ihn. Der Ingenieur dient Leuten und Instanzen, Behörden und Firmen, indem er sich an deren gar nicht bloß theoretischen technischen Problemen zu schaffen macht.
In diesen praktischen Problemstellungen begegnen ihm nun allerdings sehr viel andere Interessen als solche an menschenfreundlichen Gebrauchswerten. Ein Bauingenieur z. B. muss sich in den gerade gültigen Bauvorschriften genauso gut auskennen wie in Statik und Baustoffkunde; das „technische“ Problem, für dessen Lösung er bezahlt wird, besteht nämlich nicht zuletzt darin, diese Vorschriften möglichst unmerklich zu umgehen bzw. Möglichst billig zu erfüllen, weil der Bau eine Sache ist, die sich rentieren muss – eben deswegen ja die Vorschriften, die diesen „Sachzwang um gewisse Rücksichten allgemeiner Art ergänzen. Ein Ingenieur für Atomenergieanlagen, der sich auf die Rentabilitätsberechnungen seiner AKW-Betreiberfirma nicht versteht, wird sich nie ein funktionsgerechtes Abschaltsystem für Atommeiler ausdenken, weil ihm die wichtigsten Koordinaten für die Definition eines Störfalls fehlen. Der Autoingenieur hat das ungemein naturwissenschaftliche Problem zu lösen, „wieviel Auto“ man zu einem gegebenen Preis anbieten kann; unter der Prämisse geht das Konstruieren los und die Suche nach Werkstoffen, die das unerlässliche Minimum an Tauglichkeit zu den billigsten Kosten bieten. Maschinenbauingenieure haben ihre Aufgabe bestenfalls zur Hälfte gelöst, wenn sie einen Automaten hingekriegt haben, der menschliche Arbeit überflüssig macht; sie sollen nämlich nicht Arbeit, sondern Kosten verringern helfen, müssen sich also am Verhältnis zwischen dem Preis der Maschine und den gesparten Löhnen orientieren und vielleicht sogar ein bisschen an die Lohngruppen des noch benötigten Bedienungspersonals denken.
In manchen Anwendungsgebieten tritt der Kostengesichtspunkt auch wieder sehr zurück, weil es nur auf die Leistung ankommt, zu denen das Produkt fähig sein soll – und die es in sich haben. Da lautet etwa der Auftrag: Panzer bauen, die kein gutes Ziel bieten und die schärfsten Granaten aushalten; dazu Kanonen und Munition, die das bestgeschützte Ziel auslöschen. Noch mehr Naturerkenntnis und technologische Phantasie steckt in Ingenieurwerken wie Röntgenlasern oder „intelligenten Bomben“, die nicht bloß durch die Luft torkeln, sondern bis ins Ziel „mitdenken“. Von der „Herausforderung SDI“ ganz zu schweigen. In anderen Zusammenhängen wiederum muss die technische Optimierung gewisser Gerätschaften aus reinen Kostengesichtspunkten in die entgegengesetzte Richtung gehen: Für Elendsgebiete auf dem Globus sind wieder mehr denn je arbeitsintensive Bewässerungsanlagen, Krankenversorgungsmodelle ohne mitteleuropäische Hygienestandards, dafür unter Einbeziehung traditioneller Sterbegewohnheiten und ähnliches zu entwickeln. Auch das kann eine reizvolle Aufgabe sein.
So ist die moderne Welt angefüllt mit Errungenschaften, die ohne den massierten Einsatz von Ingenieurskunst und Sachverstand nie zustandegekommen wären: unsicheren Autos und AKWs, todsicheren Raketen und Giftgasen, potthäßlichen Stadtbildern, leicht schmierigen Weltmeeren und perfekt tiefgefrorenen Schweinebergen. Aus all dem ist dem Berufsstand der Ingenieure allerdings kein moralischer Vorwurf zu machen genausowenig wie den Autofahrern oder Stromkunden, den Soldaten oder den Bauern. Wenn sie statt dessen lieber pauschal für die sinnreichen Drehstrommotoren der neuesten Bundesbahnlokomotiven gepriesen werden wollen oder für die Entwicklung des Schwitzhemds – sei’s drum. Seltsam ist nur eine Eigentümlichkeit ihres Berufsbildes: Immerzu haben sie sich in die Bedürfnisse ihrer Auftraggeber höchst intim und solidarisch hineinzudenken, weil sie nur so das Problem richtig mitkriegen, das sie lösen sollen; die Beurteilung dieses Problems und des Zwecks, aus dem es sich ergibt, soll aber gar nicht ihre Sache sein – allenfalls ihre Privatsache, die sie als skrupulöse Christen mit ihrem Beichtvater oder ihrem Gewissen abmachen mögen, aber nie und nimmer in Form von Kritik mit ihrem Auftraggeber. Kritik dürfen sie an ihrem Auftrag üben, wenn sie sich die Absichten, die da bedient sein wollen, besser klargemacht haben als ihr Auftraggeber selbst, so dass sie dem lösungsbedürftigen Problem eine weniger bornierte Fassung geben können: Tunnel statt Brücke; elektronische Feindabwehr statt dickerer Panzerung usw. Es ist also keineswegs so, dass Ingenieure in ihrem Beruf um Eigeninitiative, selbständiges Denken und sonstige heilige Kühe des bürgerlichen Ehrgefühls betrogen würden. Gerade im Unterschied zu den Technikern, Facharbeitern oder noch niedrigeren Rängen der industriellen Berufshierarchie kommt es beim Ingenieur ganz wesentlich darauf an, dass er sich die materiellen Anliegen seines Auftraggebers voll zu eigen macht, um den dafür zweckmäßigsten Lösungsweg entdecken zu können. Genau das hat aber gefälligst ohne jede Stellungnahme zu dem theoretisch übernommenen praktischen Standpunkt zu geschehen, also unter Abstraktion von der Eigene Urteilsfähigkeit und erst recht von jedem Interesse, das sich mit dem zu bedienenden Anliegen beißen könnte – und wenn es das eigene wäre. „Dem Inscheniör ist nichts zu schwör!“, lautet das einschlägige Berufsethos – davon, dass ein Problem ihm zu abwegig, zu blöd oder zu herrschaftlich sein könnte, ist im Berufsbild nichts vermerkt.
Einem Ingenieur ist die Abstraktion von dem Zweck, um dessen technische Realisierung er sich kümmert, so selbstverständlich dass er – ebenso wie seine Mitmenschen – darin gar keine besondere Leistung erkennt; eher schon hält er es – wenn er sensibel oder links genug ist – für ein Versäumnis, dass so viele Mitglieder seines Berufsstandes sich „keinen“, und das heißt allemal: nicht seinen moralischen Vers auf ihren beruflichen Dienst machen. Als Höhepunkt der Kritik gilt der Fehler, die Technik mit den Zwecken, denen sie dient, oder gleich das Wissen selbst mit den Folgen seiner oft genug gefahrenträchtigen oder mörderischen Anwendung zusammenzuwerfen und die Naturwissenschaftler und Ingenieure für Leistungen der Politik, die ohne perfekte Technik so nicht zustandegekommen wären, moralisch haftbar zu machen. Damit ist nun allerdings an den gesellschaftlich herrschenden Zwecken nichts kritisiert – und an der wirklichen Dienstbarkeit der Technikmacher ebensowenig. Es stimmt eben nicht einmal, dass die Atomphysiker an Hiroshima schuld wären, und auch nicht, dass der Zugriff demokratischer Herrschaften auf beliebig viel Sachverstand und Ingenieurskunst durch private Gewissensbisse der angestellten Mannschaft und womöglich etliche Kündigungen zu unterbinden wäre. Es ist allenfalls ein elitärer Traum von Naturwissenschaftlern und Technikern, sie hätten die Politik dadurch von sich abhängig zu machen und unter Kontrolle zu halten, dass sie ihr nur unter Vorbehalt dienen; mit der Realität des Arbeitsmarkts für Ingenieure hat das nichts zu tun.
Statt zu einem Angriff auf den eigenartigen gesellschaftlichen Nutzen der Ingenieurskunst – einschließlich ihrer Vermarktung – taugt ein so moralisch übertriebenes Selbstbewusstsein denn auch viel eher umgekehrt dazu, den Dienst durch philosophische Grübeleien zu ergänzen, die ein schlechtes Gewissen dokumentieren – und schon damit eine schöne Entlastung des Gewisses leisten. Die meisten Ingenieure machen es sich mit ihrem guten Gewissen allerdings gleich leichter. Und auf gar keinen Fall ändert der Gewissenswurm auch nur das geringste an der eigentümlichen gedanklichen Operation, die zum Ingenieursberuf so notwendig dazugehört wie Naturwissenschaft und technologische Sachkunde: sich ein Problembewusstsein zuzulegen, das weder dem unmittelbar Eigene Interesse entspringt noch einem begriffenen und gebilligten allgemeinen Zweck, sondern sich vollständig und ausschließlich aus dem Standpunkt des zahlenden Auftraggebers herleitet.
Dieses berufsmäßige Problembewusstsein hat seinen Grund in der hierzulande durchgesetzten gesellschaftlichen Benützungsart naturkundlicher und technologischer Erkenntnisse; es garantiert deren Nutzen für die besonderen Zwecke und die herrschenden Interessen in dieser Gesellschaft – viel wirksamer sogar als jede Erziehung zu „staatsbürgerlicher Verantwortung“ oder ähnlichen ideologischen Voreingenommenheiten. Gerade so und nur so nämlich ist das produktiv anwendbare Wissen – das sich vom denkenden Individuum einerseits ja gar nicht ablösen lässt, andererseits voll und ganz – erstens ein käufliches Produktionsmittel, zweitens ein per Salär bzw. Honorar zu verstaatlichendes Macht- und Herrschaftsmittel.
Die Ingenieurskunst kann auf diese Weise tatsächlich so zum Firmeneigentum werden, dass sie von vornherein gar keinen arbeitsteilig ausgegliederten Teil der produktiven Fähigkeiten der Arbeiterschaft darstellt, sondern den Arbeitern – als in Apparaten vergegenständlichter Zwang oder als hierarchisch übermittelte Anweisung, also auf alle Fälle – als Domäne derBetriebsleitung und als wichtiges Mittel ihrer Herrschaft über den von ihr organisierten Arbeitsprozess entgegentritt. So fügt sie sich eindeutig ein in das betriebliche Ausbeutungsverhältnis, von dem Ingenieure genausowenig je etwas mitbekommen haben wollen wie alle anderen wohlerzogenen Demokraten. Grundsätzlich dienstbares Denken ist die Ingenieurskunst auch nach der Seite hin, dass sie sich vom Auftraggeberinteresse auf jeden Zweck festlegen lässt, ohne dass dieser Zweck sich vor dem Verstand des Fachmanns auch nur im geringsten irgendwie zu rechtfertigen bräuchte. Das gilt im Verhältnis zur privaten Geschäftswelt ebenso wie zur Staatsgewalt, die mit ihren Ingenieuren auch nicht diskutieren müssen, sondern mitdenkende Fachidioten ans Werk schicken können will. Mit diesem Fehler verdient der Berufsstand sich seine politischen Komplimente und mancher ein Bundesverdienstkreuz.
Den Zwang zur Dienstbarkeit üben Staatsgewalt und kapitalistischer Reichtum mit noch immer relativ guten Gehältern aus – auch wenn die Arbeitslosigkeit und der Ersatz von Ingenieursfähigkeiten durch Rechenprogramme inzwischen einige Freiheiten zur Herabstufung von Ingenieuren auf Techniker- oder Facharbeiterentgelte eröffnet hat. Guten Ingenieuren wird honoriert, dass sie nicht mit ihrem Wissen als solchem, um so mehr aber mit ihrem einfühlsamen Problembewusstsein und ihrer hemmungslosen Empfänglichkeit für Aufträge aller Art auf die Seite der gesellschaftlichen Herrschaft gehören.
Deswegen ist für Dipl.-Ings auch eine Karriere als „Selbständiger“, mit einem Eigenen Ingenieurbüro, kein bloßes Ideal. Wer sich mit Beziehungen und besonderen Angeboten an den Geschäftssinn, technologische Rechtsbeugung eingeschlossen, einen guten Ruf erwirbt, kann sogar „aus eigener Kraft“ reich werden. Andererseits dürfen auch Ingenieure das Politikergefasel von „high tech“ und Zukunft nicht als Einkommensgarantie für ihren kostbaren Kopf missverstehen. Der nationale Erfolg besteht nämlich nicht in Ingenieuren, sondern in dem kapitalistischen Reichtum und in der wirklichen Macht der Staatsgewalt, die genauso viele Ingenieure bezahlen, wie sie brauchen.
Das Konkurrieren bleibt also auch den technologischen Könnern und ihrem studierten Nachwuchs nicht erspart. Aber so merken sie gleich, wie bedingt es bloß auf Lastarm und Kraftarm ankommt, wenn man als Ingenieur im demokratischen Kapitalismus vorankommen will.
Beruf: Journalist
Der Berufsstand der Journalisten informiert über alles oder jedenfalls über alles Mögliche; er klärt und deckt auf, was aufgeklärt werden oder auch verdeckt bleiben sollte; er gibt den demokratischen Meinungsstreit wieder und bestreitet ihn zum allergrößten Teil selber; er lässt das Publikum teilhaben am großen und kleinen Weltgeschehen.
Und was hat das Publikum davon? Wozu taugt die ideelle Teilhabe an allem und jedem, für die die Journalisten hauptberuflich einstehen?
Die Antwort auf diese Frage überlässt der Journalist, der gute zumal, dem Publikum selbst. Er ist kein Agitator. Er will die Leute nicht zu bestimmten praktischen Schritten veranlassen. Er wirbt auch nicht im Regierungsauftrag dafür, dass die angesprochenen Mitbürger sich zur praktischen Beteiligung an einem Staatsbeschluss entschließen – darum muss die Obrigkeit sich schon selber kümmern, mit teuer bezahlten Anzeigen z.B., wenn es ihr darauf ankommt. Journalisten verstehen sich als Meinungsbildner, die dem Anspruch und Recht ihres Publikums dienen, über die Zustände im Eigenen Land und anderswo Bescheid zu bekommen und sich einen eigenen Reim darauf zu machen.
Diese Zurückhaltung bedeutet nun zwar keine Enthaltsamkeit in der Frage, wie und in welchem Geist die mitgeteilten Nachrichten aufgenommen werden wollen. Manche Massenblätter statten gleich ihre Überschriften mit einem „Hurra!“, „Prima!“ oder „Mist!“ aus, damit darüber erst gar kein Zweifel aufkommt; seriöse Blätter erledigen dasselbe durch könnerhafte Wortwahl: Ist irgendwo „kaum eine“ oder „eine leichte Besserung“ irgendeiner „Lage“ eingetreten? Jenseits aller Beiträge zur Stimmung des Publikums verfolgen Journalisten jedoch allesamt das Ideal, die berichtete „Sache“ und das, was ihnen dazu einfällt, erkennbar auseinanderzuhalten, Kommentar und „Meinung“ vom „Bericht“ zu trennen, beim Informieren Unparteilichkeit walten zu lassen.
Dass dieses Ideal letztendlich – wie das Idealen eben so eigen ist – doch nicht voll zu realisieren sei, betrachten Journalisten gern als die Schwierigkeit ihres Berufs; als Not, aus der sie die Tugend der Ausgewogenheit zu machen bestrebt wären. Dabei fällt das Ideal der „bloßen“ oder jedenfalls unvoreingenommenen, rein sachlichen Information und einer sauber abgeteilten Meinungskundgabe in Wahrheit zusammen mit einer außerordentlichen intellektuellen Bequemlichkeit ihres Schreib-Berufs. Damit – und mit dem Bekenntnis zur darin vorausgesetzten unpraktischen Natur ihres Geschäfts – sprechen sie sich nämlich als Berufsstand von vornherein von jedem Bedürfnis und Anspruch frei, das Berichtete zu begreifen; zu wissen, Welche Interessen inwiefern auf dem Spiel stehen und warum sie in der Weise zu Werk gehen, die den Inhalt ihres Informationswesens ausmacht.
Mit diesem Ethos der Ignoranz stehen die berufsmäßigen Informanten der Gesellschaft natürlich dauernd vor dem „Problem“, dass „die Fakten“ sich gar nicht mitteilen lassen, ohne dass ein Subjekt benannt, das Geschehen als dessen Werk – oder auch nicht – bestimmt, also ein Urteil darüber gefällt wird; von einer Nachricht könnte gar nicht die Rede sein, wenn wirklich völlig außer Betracht bliebe, wofür das Mitgeteilte steht. Journalismus besteht aber gerade – einerseits – in der schriftstellerischen Kunst, diese eigentlich unerlässliche theoretische Bemühung nach Kräften zu unterdrücken und ein Bild von den Interessensgegensätzen in der Klassengesellschaft und zwischen den Staaten, vom Wirken der öffentlichen Gewalt und der durch sie freigesetzten privaten Gewalttätigkeit, von alltäglicher Unterordnung und gesellschaftlicher Verblödung zu entwerfen, ohne dass dieser Inhalt ausgesprochen wird und folglich ohne dass die Betroffenen sich zu einem korrigierenden Eingreifen oder gar zu einem Umsturz der täglich fortgeschriebenen Widrigkeiten herausgefordert sähen. Das Ideal der Sachlichkeit, das Journalisten verfolgen, besteht insoweit im zäh festgehaltenen Entschluss zur Begriffslosigkeit und verleiht schon damit dem gesamten Nachrichtenwesen der bürgerlichen Gesellschaft den Charakter der prinzipiellen Schönfärberei, Welche ein ebenso prinzipielles Abraten von dem Übergang zu praktischem Eingreifen einschließt.
Andererseits stehen selbst die oberflächlichsten „Notizen vom Tage“ nicht einfach nur so „im Raum“; diese logische Unmöglichkeit kriegen auch Journalisten nicht hin. Auch die von ihnen hergestellten Nachrichten sind Urteile; und die geben – noch vor aller Besonderheit bei ihrer Auswahl, Formulierung und Kommentierung – Zeugnis von dem Geist, in dem sie überhaupt zustande gebracht und als bemerkenswerte Neuigkeit in Umlauf gebracht werden.
Der dem Journalistenstand von Berufs wegen eigene Geist, der jedes praktische Interesse und theoretische Begreifen ersetzt, besteht in der Attitüde der Verantwortung: Ständig stellt sich die – wenn auch meist unausgesprochene – Frage, wie „man“ „es“, das Berichtete nämlich, anders, besser, gelungener hätte anstellen können und sollen. Das stillschweigend angesprochene „man“, das kein wirklich praktisches Subjekt und keinen wirklich praktischen Zusammenhang zwischen Lesern und berichtetem Geschehen namhaft machen will, nimmt statt dessen das informierte Publikum ganz prinzipiell für den Standpunkt verantwortlicher Betreuung aller Ereignisse in Anspruch – einen Standpunkt, der alles Mögliche sein mag, nur ganz sicher nicht der wirkliche Standpunkt der praktischen Lebensführung der unterrichteten Massen. Dieses stillschweigende Ansinnen brauchen gute Journalisten sich gar nicht erst extra als moralische Botschaft zurechtzulegen. Es ergibt sich ganz von selbst aus ihrer berufseigenen Manier, sich in Gedanken genau so allem Geschehen zu widmen, wie sie es den wirklichen Machthabern als deren praktische Stellung abgeschaut haben: mit dem Gestus des allüberall zuständigen Aufsehers und Managers. Diese pseudopraktische Manier, in Gedanken und ohne Ernst den Standpunkt der politischen Instanzen einzunehmen, die alles zum Material ihrer Zuständigkeit machen, prägt alle Berichterstattung bürgerlicher Journalisten – nicht bloß über politische, ökonomische und militärische Großtaten der nationalen Führungsmannschaften zu Hause und anderswo, sondern ebenso über Unfälle und Sportereignisse, Naturkatastrophen und dramatische Schicksale, den Alltag der Prominenz und die Lebenskünste der „kleinen Leute“. Und sie ist das solide Fundament des recherchierenden, kommentierenden, auf alle Fälle unterhaltsamen Umgangs der Journalisten mit ihrer selbstgeschaffenen Nachrichten„flut“.
So ist es von diesem Standpunkt aus zuerst einmal nur logisch, dass an der Spitze aller Nachrichten und Zeitungsseiten, noch vor den begutachtenden Journalisten selbst, die Politiker das Wort haben. Deren Macht schafft ja die allermeisten Neuigkeiten; und bei ihnen hat die Manier des fürsorglichen Umgangs mit dem Geschehen in all ihrer Verlogenheit praktische Bedeutung: ihre „Meinungen“ sind selbst ein Stück politische Realität. Deswegen ist es ein Gebot journalistischer Sachlichkeit, die Funktionäre der Macht erst einmal ausgiebig für sich selber sprechen zu lassen.
Dass deren Äußerungen – je nach Amt – Machtworte sind, das kritisieren die Agenten des Nachrichtenwesens nicht, sondern das würdigen sie, indem sie die Bedeutung und das sachliche Gewicht ihrer Informationen in allererster Linie nach der Herrschaftsfunktion der Figuren bemessen, aus deren Geschäftsleben sie berichten. Sie geben nicht bloß Nachricht von den Gewaltverhältnissen, die den benachrichtigten Massen ihren Platz im Leben anweisen; sie reproduzieren mit ihrer objektiven Berichterstattung den Anspruch der Gewalthaber, dass die Werke, Vorhaben und Beschlüsse der Politik als unwidersprechliche Fakten hingenommen werden, auf die die ohnmächtig Betroffenen sich – erfreut oder verärgert, aber prinzipiell opportunistisch – einzustellen haben wie aufs gute oder schlechte Wetter, über das in derselben Manier informiert wird.
Die Steigerung dieser Sorte Sachlichkeit heißt Authentizität: Aus erster Hand die Pläne der Machthaber erfahren, aus ihrem Eigene Mund, per Interview oder von Informanten aus der nächsten Umgebung der wichtigen Persönlichkeit verbürgt, das macht eine gute Berichterstattung aus.
Dabei haben Journalisten durchaus ein Bewusstsein von dem Dienst, den sie den Machthabern mit der nachrichtlichen Weitergabe geäußerter Vorhaben und Einschätzungen als gewichtiger, prägender Fakten leisten; allerdings von Berufs wegen ein verkehrtes. Sie übersehen glatt die Hauptsache, nämlich dass sie mit ihrer Berichterstattung die betroffenen Leute auch noch theoretisch in die Position versetzen, in der diese sich praktisch sowieso befinden, nämlich in die Lage der ohnmächtigen Hinnahme des von den gewalthabenden Instanzen Beschlossenen. Sehr klar ist ihnen dafür die andere Seite dieses Verhältnisses: dass sie mit ihrer Berichterstattung den Auffassungen und Interpretationen der politischen und sonstigen Machthaber die Würde und das Gewicht eines mitteilenswerten Ereignisses verleihen, einer Tatsache, auf die „man“ sich – wie auch immer – einstellen muss. Journalisten neigen dazu, Fakten, die nicht durch sie das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben, für nicht existent zu halten; und auf alle Fälle genießen sie die Identität von Faktum und Nachricht, an die sie glauben, als ihr besonderes Stückchen politischer Macht.
Tatsächlich gibt es eine Sphäre, in der ihr prinzipieller Handlangerdienst für die Macht eine Kehrseite aufweist: Für die Konkurrenz der Politiker um die Teilhabe an der Macht spielt das Gewicht eine Rolle, das die Journalisten deren Lagebeurteilungen und Vorschlägen beilegen. „Schlagzeilen machen“ ist ein Konkurrenzmittel – eben weil die Schlagzeile den Furz eines Machthabers zum bedeutenden, einflussnehmenden politischen Faktum macht. Dieser Dienst ist das Machtmittel, das Journalisten den wirklichen Machthabern gegenüber wirklich besitzen; weit bedeutender als die per Aufmache und Kommentar dazugestellte gute oder schlechte Meinung – nichts ist so vernichtend für einen politischen Mitkonkurrenten wie das Desinteresse der Journalisten, denn es kommt dem Verdikt der Unerheblichkeit gleich. So ist bestens gesorgt für eine gediegene Kumpanei zwischen den Journalisten, deren Berufsglück mit der Authentizität ihrer Quellen, also mit ihrer Intimität mit den Machthabern wächst, und den Politikern, deren Konkurrenzerfolg Publizität als Mittel braucht.
Natürlich will ein Journalist mehr sein als bloß Sprachrohr und Kumpan der Machthaber. Er versieht seinen Dienst für die Macht und deren Inhaber als Dienst am Publikum und dessen „Informationsbedürfnis“, als Vertretung und Vollstreckung eines Menschenrechts auf Nachrichten: der Freiheit, über alles in Kenntnis gesetzt zu werden, was die Machthaber mit ihrem Volk anstellen, und sich darüber verantwortliche Gedanken zu machen.
In diesem Sinne sind Journalisten berufsmäßige Vertreter des albernen Verdachts, Politiker würden ihre wirklichen Vorhaben am liebsten verheimlichen, und was sie kundtun, wäre in Wahrheit gar nicht so gemeint. Mit Kritik an amtlichen Ideologien – geschweige denn an der Politik, deren authentische Selbstinterpretation ja ebenso eine objektive Nachricht wert ist wie ihre Wirkungen – hat dieser Verdacht nichts zu tun. Er besteht in einem Zweifel, der in der Logik des machtlosen Bürgers erst hinter der anerkannten Selbstverständlichkeit von Herrschaft und Machthabern kommt, dort aber gar nicht ausbleiben kann: Ob „die da oben“ es auch wirklich und ernstlich so gut mit ihren regierten Massen meinen, wie sie es bei jeder Gelegenheit beteuern; ob gerade sie so viel Unterwürfigkeit verdienen, wie ihre Macht an Unterwerfung durchsetzt, oder nicht eher ihre Konkurrenten. Diesen Zweifel bedienen Journalisten mit Hintergrundberichten, die die Frage nach den Zwecken, den wirklichen Gründen des Geschehens vollkommen ersetzen. Sie forschen aus, wie die regierenden Persönlichkeiten ihre Regierungs- bzw. Konkurrenzgeschäfte betreiben: wie sie Pflicht und Neigung unter einen Hut bringen, was Privatleben und Familie dazu sagen usw. Heiß und begierig werden sie, wenn ihnen Anzeichen für Ehrlosigkeit und Pflichtverletzungen in die Hände fallen; dann bedienen sie die politische Konkurrenz mit der Inszenierung eines Skandals. Dabei sind sie den „Opfern“ ihres Saubermanns-Standpunkts selbstverständlich auch die Wiedergabe sämtlicher Gesichtspunkte schuldig, unter denen diese ihr Tun und Lassen für geboten und höchst ehrbar halten, so dass auch das Skandal-Machen nicht in mangelnde „Objektivität“ und fehlende „Ausgewogenheit“ ausartet; sonst ist nämlich das der eigentliche Skandal. Auch dieser bedenkliche Zweig journalistischer Entdeckerfreude mündet so allemal wieder ein in den Hauptstrom demokratischer Hofberichterstattung, die, jenseits aller moralisierenden Einwände, vor allem die Wichtigkeit der Figuren herausstellt, um die sie sich kümmert: Bei denen ist alles eine Nachricht wert.
Genauso wichtig wie die Erkundung der Hintergründe des politischen Geschehens ist fürs journalistische Geschäft die „kritische Auseinandersetzung“ mit den guten Gründen, die die Politiker für ihr Handeln anzuführen wissen und auf Pressekonferenzen u. ä. den Journalisten zur sachlichen Berichterstattung anvertrauen. In Kommentaren und Leitartikeln wird der Gesichtspunkt, der das journalistische Nachrichtenwesen stillschweigend ohnehin immerzu leitet: die zum Standpunkt geronnene Erkundigung nach möglichen Alternativen eines verantwortlichen politischen Managements, zum wonnevoll breitgetretenen Hauptthema: Jede Redaktion eine ideelle Schattenregierung!
Der Gestus der Verantwortlichkeit – „Wie hätte man es besser machen können?“ – feiert da seine Triumphe. Unentgeltlich eingeschlossen ist in diesem Kommentarwesen, jenseits aller „sachlichen Kritik“, eine grandiose Verharmlosung der sorgenvoll begutachteten politischen Geschäfte: Die Regierung erscheint wie eine übergeordnete Redaktionskonferenz; die Praxis staatlicher Gewalt, die Interessensgegensätze einrichtet und manches Interesse souverän weg“regelt“, als Ausfluss von solchen rein theoretischen Harmlosigkeiten wie „Programmen“, „Konzepten“ und „Visionen“ – oder auch, je nachdem, von „Missverständnissen“ und „Kurzsichtigkeiten“, die die Politiker bei ihrem Tun geleitet hätten. Dabei greifen Journalisten gern jeden höheren Gesichtspunkt auf, den die Geistesfreiheit zur Rechtfertigung und Verhimmelung staatlicher Interessen und Gewalttaten hervorgebracht hat; besonders solche, die gerade in Mode sind und durch sie in Mode kommen. Hierbei leistet ihnen wieder ihr Sinn für Sachlichkeit gute Dienste: Sie wägen die albernen Abstraktionen, die das politische Geschäft der Staatsgewalt als geistige Gestaltungsaufgabe hinstellen, nach deren praktischen Erfolgen im verbindlichen gesellschaftlichen Zitatenschatz ab – also vor allem nach ihrer Beliebtheit bei den Machthabern, die zu ihrer Politik gleich auch noch die passenden Sprachregelungen auszugeben pflegen. Dass Politik so am Ende wie eine Diskussionsrunde aussieht, in der Machthaber und Journalisten einander gleichberechtigt und kongenial ins Wort fallen, und nur noch nach den ideologischen Rechtstiteln gewürdigt wird, die für und wider sie angeführt werden, ist hier die wichtigste Dienstleistung des Journalistenstandes für die Macht.
Dieser Dienst hört nicht auf, sondern fängt erst so richtig an, wenn’s ans Kritisieren geht. Wenn Journalisten geistige Inkonsequenzen, falsche Konzeptionen, fehlende oder zu utopische Zielvorstellungen und dergl. Bei den Machthabern geißeln, dann bekräftigen sie bloß diesen lächerlichen Schein, Politik wäre „letztlich“ nichts als ein großer „gesellschaftlicher Diskussionsprozess“. Dieser Schwindel bleibt nicht bloß praktisch als allgemeines Endergebnis aller Kommentare übrig; er ist beabsichtigt. Je kritischer“ sie werden, um so verantwortungsbewusster haben Journalisten das höchste methodische Ideal aller demokratischen Schönfärberei im Auge: die Glaubwürdigkeit der Politik – d.h. der Lüge, in ihr wäre, „eigentlich“, die gesammelte Vernunft der Gesellschaft praktisch am Werk. Dieses Kriterium gibt ihnen die einzige Kritik ein, die sie je ernst meinen – dass nämlich gewisse Politiker es ihnen schwer machen, dem Volk ihre Heldentaten als Einsatz für edle Zwecke, und sei es ein tragisch verfehlter Einsatz, eingängig zu machen. Dann „müssen“ sie mit kunstvollen Sprachregelungen und abgewogenen Äußerungen des Abscheus das vermeintlich Angerichtete wiedergutmachen und dafür sorgen, dass die Unglaubwürdigkeit gewisser Politiker keine „Glaubwürdigkeitslücke“ bei der Feier der Politik aufreißt und dass keine „Staatsverdrossenheit“ einreißt.
Gegen die Gefahr politischen „Vertrauensverlustes“, die sie allenthalben entdecken, kämpfen die Journalisten an, indem sie – auch das jenseits aller politischen Differenzen und unterschiedlichen Vorlieben für den einen oder anderen Konkurrenten um die Macht – den Standpunkt der politischen Führungskunst und die höheren nationalen Gesichtspunkte pflegen, vor denen die Politiker sich zu bewähren und an denen aufgeklärte Bürger sich zu orientieren hätten. Sie leben der Einbildung, sie müssten sich die ideellen „Richtlinien der Politik“ ausdenken, an denen Kanzler und Präsident es mehr oder weniger fehlen lassen und an denen es der ungebildeten Bürgermeinung nur zu leicht mangelt, und dadurch das „Vertrauen bilden“, das sie die Politiker fortwährend leichtfertig verspielen sehen. Es liegt in der Natur dieses Anliegens, dass ihnen im Zweifelsfall allemal nur ein und dasselbe auffällt: Die Nation könnte durchaus noch machtvoller dastehen; und zwar vor allem dann, wenn die politische Führung machtvoller führen würde. In Abwandlungen des reinsten Herrschaftsgedankens erschöpft sich der Pluralismus eines unzensierten Journalismus.
Dabei vergisst ein demokratischer Journalist nie, bei allem Engagement für Führungskultur und mündigen Gehorsam, dass es ihm von Berufs wegen durchaus nicht zukommt, den berufenen Führern wirklich ins Handwerk zu pfuschen. Er kennt und respektiert die Voraussetzung, unter der seine wohlmeinenden Beiträge überhaupt bloß ihr Publikum finden: Er unterstellt und bezieht sich auf ein Problematisierungsbedürfnis, das weder mit dem Drang zu praktischer Einmischung noch mit einem Interesse an praktisch hilfreicher Erkenntnis irgend etwas zu tun hat. Schreibende Journalisten wissen, dass es von ihrer „Schreibe“ abhängt, ob ihr Schmarrn gelesen wird; Rundfunkjournalisten verwenden die meiste Mühe auf eine ansprechende Präsentation ihrer Einfälle; Auflockerung, durch Bildlein z.B., ist unerlässlich, ein gefälliges Arrangement ebenso; Abwechslung und Farbigkeit sind ebenso gewichtige journalistische Werte wie Sachlichkeit und demokratische Prinzipientreue. Der Journalist ist erst fertig, wenn es ihm gelungen ist, seinen Stoff unterhaltsam zu machen.
An diesem Kriterium aus der Welt des Genusses und Geschmacks unterscheiden sich journalistische Machwerke gerechterweise sehr viel gründlicher voneinander als in ihrer politischen Tendenz. Das eine Publikum will eben mehr durch blutrünstige Illustrationen, das andere mehr durch furchtbar hintergründige Hintergründe unterhalten sein; das eine findet die große Welt des Völkerrechts, das andere die kleine Welt des Kriminalrechts interessanter – mit praktischen Interessen der informierten und belehrten Leute hat das eine wie das andere ohnehin nichts zu tun. Der eine Geschmack findet sich durch dicke Schlagzeilen, der andere durch betulichen Satzbau besser angesprochen; und die Analphabeten dürfen auch nicht leer ausgehen, haben vielmehr ihr Recht auf einfältige Schaubilder – Studienräte können ja dasselbe kompliziert ausgedrückt nachlesen.
Jenseits aller Geschmacksdifferenzen folgt die journalistische Zubereitung der Nachrichtenwelt zum Genuss der härtesten Sorte dann doch wieder einem recht einheitlichen Rezept, dessen Beherrschung es dem tüchtigen Journalisten leicht macht, nach oder nebeneinander den verschiedensten Herren zu dienen. Die angestrebte Vergnügung des Publikums liegt darin, es in den disparatesten Ereignissen immer dieselben leicht fasslichen und geläufigen, moralisch erbaulichen und problemlos zustimmungsfähigen Prinzipien wieder entdecken zu lassen, so dass es in Gedanken Beifall spenden oder Missfallen empfinden kann. Journalistisch aufbereitet, zeugen Fußballspiele und Kriegsvorbereitungen, Steuergesetzänderungen und Naturkatastrophen, Unfallstatistiken und Wahlkampfskandale allesamt in sehr durchsichtiger Weise vom bedingungslosen Recht der nationalen Sache, der hohen Verantwortung ihrer Sachwalter, der Notwendigkeit ihrer ordentlichen Durchsetzung – das wären sie schon so ziemlich, die sinnstiftenden Prinzipien, deren Wiedererkennung die eine Hälfte des Unterhaltungswerts von Nachrichten, Kommentaren und Reportagen ausmacht. Die andere Hälfte liegt in der bunten Vielfalt tatsächlicher Geschehnisse, die täglich neu diese paar Grundsätze „bestätigen“. Dauernde Abwechslung ist unerlässlich, um über die störende Wahrheit hinwegzutrösten, dass die von den Journalisten gepflegte und bediente gesellschaftliche Neugier nur einen „Stoff verlangt und zu verdauen vermag, nämlich das ödeste und langweiligste Einerlei.
Genossen wird daran die Einbildung, mit den Maßstäben des Eigene Urteilsvermögens ideell an all dem verantwortlich beteiligt und all dem geistig gewachsen zu sein, was ohnehin, und zwar von ganz anderen Machern als den neugierigen Betroffenen, ins Werk gesetzt wird. In dieser Illusion liegt schließlich die Freiheit demokratischer Bürger – von Leuten, die sich gar nicht in der Lage befinden und auch gar nicht darauf erpicht sind, dass sie ihre Existenzbedingungen nach dem Eigene Interesse beurteilen, beratschlagen und ins Werk setzen; die sich vielmehr als das machtlose Publikum ihrer Eigene Lebensumstände aufführen und denen alles zum Aktiv-Werden fehlt. Außer in der einen, ganz unpraktischen Hinsicht: mit Beifall oder Ärger zu reagieren und zufrieden zu sein, wenn sie diese Reaktion öffentlich verkündet finden.
Genau das ist das Metier der Journalisten; dieses Bedürfnis befriedigen sie. So sorgen sie dafür, dass das demokratische Volk nicht bloß täglich durch Staatsgewalt und Wirtschaftskraft der Nation zweckdienlich benutzt wird, sondern auch noch als Gemeinschaft freier Geister gewürdigt – nämlich nach Strich und Faden für dumm verkauft.
Beruf: Kapitalist
Ob Arzt oder Professor, Ingenieur oder Psychologe – jeder ehrenwerte Berufsstand schmückt sich zum Ausweis seiner Ehrenhaftigkeit mit dem Anspruch, sein Metier zeichne die heutige Gesellschaft aus; und er bekommt darin öffentlich recht. Vom Zeitalter der Medizin oder Technik, vom Jahrhundert Freuds oder der Wissenschaft, von der Bildungs- oder Informationsgesellschaft ist deshalb allenthalben die Rede. Nur von kapitalistischer Gesellschaft und von Kapitalismus hört man nichts mehr. Diejenigen, die mit nichts als dem zweckmäßigen Einsatz von Kapital zu seiner Vermehrung beschäftigt sind, wollen partout nicht Kapitalisten heißen; bestenfalls in vergangenen Zeiten soll es die mal gegeben haben. Ausgerechnet der Berufsstand, der die ökonomischen Grundsätze repräsentiert, nach denen sich jedermann richtet, treibt ein Verwirrspiel mit seinem Namen und lässt seine Profession verleugnen.
Dass ausgerechnet in der kapitalistischen Gesellschaft Kapitalist und Kapitalismus als Schimpfwörter und Verleumdung auf den Index öffentlicher Sprachregelungen gesetzt sind, ist dem Respekt – dem einzigen – geschuldet, der Marx heute noch gezollt wird: Er habe diesen Berufsstand erfolgreich, wenn auch völlig zu Unrecht, schlecht gemacht. Deshalb kennt man sie heute unter anderen Namen, die kleine Abteilung von „Unternehmern“ aller Art, die sich dumm und dämlich verdienen und selbstbewusst glauben das wäre ihr Verdienst und schwer gerecht. Namen, die zum Ausdruck bringen, dass dieser wohldefinierte Personenkreis – die „Arbeitgeber“ oder kollektiv: „die Wirtschaft“ – ein zutiefst berechtigtes Ansehen genießt, wenn er seinen Geschäftsinteressen nachgeht. Die Befürwortung der Werke, Welche der „Wirtschaft“ obliegen, ist da eine ausgemachte Sache. Und zwar mit dem – explizit oder stillschweigend – geltend gemachten Argument, dass von den Entscheidungen und Erfolgen dieses Gewerbes mit seiner seltsam abstrakten Natur so gut wie alles abhängt.
Dem damit verbundenen kategorischen Imperativ, sein Dichten und Trachten darauf zu richten, dass „der Wirtschaft“ möglichst alle Probleme erspart bleiben, sollte man besser nicht folgen, wenn man wissen will, wodurch sich das gesellschaftliche Wirken besagten Personenkreises auszeichnet. Dann versteht man auch ihre Probleme besser.
Zunächst einmal schlagen alle gut gemeinten Versuche fehl, die Frage „Warum sind die eigentlich ‚die Wirtschaft‘?“ mit Hilfe der demokratischen Medien und ihrer Informationsbereitschaft zu klären. Bei aller Mitteilungsfreude über Vergnügungen und familiäre Großtaten stellt sich einfach kein Charakterzug, keine „menschliche“ Besonderheit heraus, der die Herren und Damen vor anderen Zeitgenossen dazu prädestiniert, auf die „Wirtschaft“ aufzupassen. Sie essen und trinken, gehen aus, setzen ihre Kinder auf die Schaukel oder ins Auto, oder sie geben besorgniserregende Befunde über Öl-, Automobil- und andere Krisen zu Protokoll lauter Sachen, die Professoren, Betriebsräte, Zeitungen und Stammtischbesucher auch vermelden. Manche haben Abitur, manche wieder nicht, selbst Hobbys können sie nachweisen. Noch nicht einmal Zylinder, das ihnen in gewissen Kreisen zugedachte Markenzeichen, tragen sie bei ihren Terminen; höchstens eines fällt auf bei den zahlreichen Zeugnissen davon, wie sie es mit dem Leben so halten: Geld spielt keine Rolle. Das hat allerdings nun mit der „Persönlichkeit“ herzlich wenig zu tun.
Zu bedeutenden Persönlichkeiten werden Unternehmer dadurch, dass sie von Berufs wegen ebenfalls mit Geld befasst sind, und zwar auf eine Weise, die mit ihrem Konsum nur so viel zu schaffen hat, dass sie ihren privaten Verbrauch aus den Erträgen ihres Geschäfts finanzieren. Jener berufliche Umgang mit Geld beruht darauf, dass diesen Bürgern ein Vermögen gehört, das sie zum Zwecke seiner Vermehrung einsetzen. Sie nennen es Kapital, und die Tatsache, dass sie es nicht ausgeben für ihre persönlichen Genüsse, sondern investieren, hat wohlwollende Beobachter ihres Treibens dazu angeregt, ihr Geschäft mit der Kunst der Entsagung und des Sparens gleichzusetzen. Dabei besteht ihre Tätigkeit keineswegs in lauter Akten der Unterlassung, sondern in lauter Entscheidungen zur Teilnahme am Marktgeschehen.
Die Industriellen kaufen sich von ihrem Vermögen einen Betrieb, erwerben also Produktionsmittel und Materialien, an denen sich gegen einen Lohn Arbeiter zu schaffen machen, so dass die Firma etwas zum Verkaufen hat. Die Differenz zwischen Erlös und eingesetztem Kapital ist der Gewinn. Er bildet den Zweck der ganzen Unternehmung, weil er das Vermögen vergrößert.
Große Geheimnisse sind damit freilich nicht ausgeplaudert. Das weiß ein jeder, dass in der freien Marktwirtschaft die Entscheidung darüber, ob und wie etwas produziert wird, aufgrund von unternehmerischen Kalkulationen fällt. Daran ist die demokratisch verwaltete Menschheit gewöhnt, dass sich Güter aller Art als Geschäftsartikel zu bewähren haben, dass ihr Preis das Bedürfnis nach Gewinn zu befriedigen hat und darin die Bedingung festgeschrieben ist dafür, dass die gewöhnlichen Bedürfnisse zum Zuge kommen. Öffentliches Ärgernis ruft bestenfalls die Behauptung hervor, dass der Staat mit der Lizenzierung des Privateigentums eine Klasse ins Leben ruft, deren Privatinteresse an der Vermehrung ihres Vermögens zur allgemeinen Existenzbedingung des Rests der Welt wird, der im Dienst am Gewinn aufgeht und dabei notwendigerweise schlecht fährt. Dieser Staat, der sich auch dazu herbeilässt, die Zuwächse an Privatvermögen zusammenzuzählen – was die Eigentümer selbst geflissentlich unterlassen – und mit dem „Wirtschaftswachstum“ seine Vorliebe fürs Privateigentum zum Prinzip zu erheben, dem niemand in die Quere kommen darf, bekennt sich zum Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit. Das Kapital trägt diesen Gegensatz aus, indem es sich auf die rechtliche Erlaubnis zur Eigentumspflege beruft und jedermann die dafür erforderlichen Maßnahmen als „Sachzwang“ aufherrscht. Die Kapitalisten verwenden ihren gesamten Einfallsreichtum darauf, aus ihrem Geld mehr Geld zu machen, betonen ein ums andere Mal, dass vom Gelingen der Bewegung G – G‘ alles abhängt – und streiten gleichzeitig ab, dass sie nichts anderes seien als personifiziertes Kapital. Unter „Verantwortung“, „Initiative“, „Leistung muss sich lohnen“ und „wir schaffen Arbeitsplätze“ geht da nichts wenn sie ihr Recht zur Vollführung von G – G‘ in lauter Pflichten und Beschränkungen der anderen übersetzen. Weil ihre Privatsache in den Rang eines allgemein geltend gemachten Anliegens erhoben ist, verfügen sie über das selten glückliche Klassenbewusstsein, bloße Diener ihrer eigenen Interessen zu sein. Bei diesem Dienst richten sie all das an, was den bürgerlichen Verstand unter dem Titel „sozial“ beschäftigt und dem Klassenstaat als zu bewältigende „Fragen“, „Übel“, „Missstände“ und „Ungerechtigkeiten“ angetragen wird.
Bei den „Beschäftigten“ wird aus dem Verhältnis von Lohn und Leistung, das so entscheidend für den Gewinn einer industriellen Unternehmung ist, eine einzige Ansammlung von Existenzproblemen. Der Standpunkt der Lohnkosten produziert den Geldmangel der anderen Seite, die Ausdehnung der Arbeitszeit beschränkt die frei verfügbare Lebenszeit. Der Preis der Konsumgüter mindert die Brauchbarkeit der Lohnsumme, weil er den Gewinn garantieren muss. Die Erhöhung der Leistung pro Zeit, die eine rentable Ausnützung der teuren Produktionsmittel gewährleistet, geht auf die Gesundheit; gleichzeitig werden Arbeitskräfte überflüssig, die sich dann auf dem „Arbeitsmarkt“ tummeln, sooft die Produktion „rationalisiert“ wird. Die so erzeugte Armut lässt die gewöhnlichen Einkommens- und Existenzsorgen der Lohnabhängigen schon wieder als Segen erscheinen, wenn man sich auf Schadensvergleiche versteht. Zudem tut die Intensivierung der Arbeit in der Unfallstatistik ihre Wirkung, die zur Quote von gewöhnlich Kranken hinzukommt. Und jedes Problem, das ein Betrieb mit seiner Bilanz aufgrund der „Marktlage“ mit Konkurrenz und Konjunktur bekommt, artet in eine erneute Zuständigkeit der Lohnabhängigen aus, die für das Gelingen von G – G‘ seltsamerweise immer geradezustehen haben. Dabei haben sie überhaupt nichts zu melden, weil es um die Bilanz ihres Vermögens ja gar nicht geht. Ihnen bleibt nur ein Weg, sich um sich zu kümmern: Sie müssen sich als Mittel des Gewinns bewähren, und das geht über billig, Leistung und Opfer. Das hebt ihren „Lebensstandard“, den ein marktwirtschaftlicher Demokrat nicht anders zu würdigen weiß als durch lauter Vergleiche mit früher und anderswo, weil da mit der Brauchbarkeit der mittellosen Menschheit auch deren Ernährung gleich ganz entfällt. Entrechtet ist die arbeitende Klasse bei alledem nicht. Sie darf sich sogar um die „Umwelt“ sorgen, wenn sie feststellt, dass der rücksichtslose Umgang mit der Natur zwar „Wachstum“ hervorgebracht hat, aber auch elementare Lebensmittel in Gesundheitsrisiken verwandelt …
Es wäre ungerecht, den kapitalistischen Industriellen vorzuwerfen, nur auf Kosten einer anderen Klasse, die über kein investierbares Vermögen verfügt, ihr Geschäft abzuwickeln. Sie eröffnen auch Gelegenheiten des Dienstes, die sich auszahlen.
Um den Handel mit ihren Produkten schwungvoll zu gestalten, treten sie die Aufgabe des flächendeckenden Verkaufs an andere ab, die sich an ihrer Stelle mit der Erforschung und Ausnützung des Marktes befassen. An der Geschwindigkeit seines Umsatzes interessiert, lässt sich der Unternehmer in seiner Eigenschaft als Anbieter von Waren gerne vertreten. Aus dem Kauf seiner Produkte und ihrem Verkauf wird ein selbständiges Geschäft, in das es sich zu investieren lohnt. Deshalb gibt es ein Handelskapital, das von der Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis „lebt“, d.h. Gewinn macht, weil es den Industriellen Kosten erspart. Nebenbei bringt der Konkurrenzkampf um Marktanteile also eine ganze Zunft von investitionsfreudigen Kollegen hervor, stiftet ein paar interessante Berufe wie die des Vertreters und Werbefritzen, die Gott und die Welt von der preiswerten Ware überzeugen, die sie losschlagen wollen. Ganz zu schweigen von den Kleinhändlern, die ihr weniges Kapital durch ihre und ihrer Familie Arbeit vermehren. Neben ihrer ökonomischen Funktion kommt letzteren wie den Handwerksbetrieben eine nicht zu unterschätzende ideologische Bedeutung zu: An ihnen wollen problembewusste Zeitgenossen und sie selbst erkannt haben, dass Geschäft und Arbeit ungefähr ein und dasselbe sind. Dabei beweisen sie nur, dass Kapital unterhalb einer bestimmten Größe nichts Gescheites ist, weil es die Trennung von Funktion und Eigentum nicht erlaubt.
Diese Trennung ist für einen „Industriellen“ selbstverständlich – der trifft Investitionsentscheidungen und unterschreibt Verträge, die ihm seine „Abteilungen“ nahelegen und präparieren. Unter seinem Personal finden sich technische Fachleute und „Vorgesetzte“, die die Produktion organisieren und kostengünstig auslasten So sorgen Kapitalisten für die Anreicherung der Berufshierarchie, in der Lohnabhängige ihre Konkurrenz austragen und für den Beweis gut sind, dass es auf den Gegensatz von Kapital und Arbeit nicht (mehr) ankommt, weil es ja so viel dazwischen gibt. Als ob Funktionen des Kapitals, als besserbezahlte Lohnarbeit verrichtet, das Klassenverhältnis außer Kraft setzen würden!
Wegen der Kontinuität ihrer Geschäfte, wegen ihrer Sorge um „Liquidität“ zu jedem Zeitpunkt, an dem wieder gekauft, also bezahlt werden muss, lassen sich Industrielle auch den nötigen Kredit etwas kosten. Daher lohnt sich auch das Geschäft der Geldkapitalisten, die sich mit dem zinsträchtigen Handel mit Schulden befassen. Ihr Geschäftsartikel ist Geld, das einen Preis hat – einen, den sie zahlen, weil es ihnen überlassen wird, und einen, den sie verlangen für gegebenen Kredit. Mit der arbeitenden Klasse haben diese Kollegen nur insofern etwas zu tun, als sie deren Spargroschen kapitalisieren. Ansonsten beschränken sie sich auf die Beschäftigung von Angestellten, die garantiert nichts produzieren und doch ein Gehalt beziehen, was einen Beitrag zur Widerlegung der „Arbeitswertlehre“ abgibt – wenn man es so sehen will. Einmal in Aktion, betreuen Bankiers schlicht den Kapitalmarkt. Sie sorgen dafür, dass jeder Pfennig Geld, der nicht per Versilberung von Waren aus G ein G‘ machen hilft, als Kapital fungiert, als „Geld arbeitet“. Banken sind Einrichtungen, die Ernst machen mit dem Recht des Eigentums auf seinen Zuwachs. Und wenn die Gewährung dieses Rechts in Gegensatz gerät zu den tatsächlichen Erträgen, findet Wechsel und/oder Entwertung von Eigentum statt, nie aber dessen Infragestellung. Dass die Investition von Kapital nichts mit der Besonderheit der Produktion, mit der Eigenart des Produkts zu tun hat – diesen Beweis bleiben die Banken jedenfalls nicht schuldig. Im Handel mit „Papieren“ aller Art emanzipiert sich die besitzende Klasse sehr offenkundig von der Festlegung ihres Kapitals auf irgendeine Branche des Geschäfts. Sie vergleicht Zinsen mit den Erträgen einer Fabrik, den Kurs von Aktien miteinander und mit Staatsanleihen und anderes mehr – und am Ende ist nicht nur das Vermögen der Bank „gestreut“.
Die guten Werke der Kapitalisten sind keineswegs damit erschöpft, dass sie sich in den Kollegen von der Handels- und Kreditfront eine Konkurrenz leisten, die schließlich dahin führt, dass ein halbwegs potenter Geschäftsmann in sämtlichen Abteilungen zu Hause ist bzw. Banken überall beteiligt sind. Kapitalisten brauchen auch nicht nur Arbeiter, sondern auch jede Menge staatlichen Engagements für ihr Geschäft.
Auch das schafft Arbeitsplätze, nämlich die ganze Berufswelt der Staatsdiener: Politiker aller Parteien machen sich für die Sachnotwendigkeiten des Wachstums der nationalen Wirtschaft stark, die mit aller Macht nach innen und außen gefördert und zur freien Betätigung befähigt wird; Lehrer stehen für die Auslese in der Ausbildung ein, die dem Arbeitsmarkt genügend arbeitswilliges und zu sonst nichts berechtigtes Material zuführt; Naturwissenschaft und Technologie gedeihen unter universitärer Obhut und dienen so den Konkurrenzinteressen des Kapitals, das erst in der Phase der Machbarkeit ein Geschäft aus der Wissenschaft zu machen weiß; ideologische Betreuung der gebeutelten Menschheit tut immer not – die staatliche Pflege des entsprechenden Geistes in Forschung und Lehre findet statt. Kurz: Die Skala der Berufe in Universität und Schule steht in einem eindeutigen Verhältnis zu den Erfordernissen des Kapitals. Dasselbe gilt für den Ärztestand, Versicherungsvertreter und andere Volksbetreuer.
Die Kapitalisten sorgen also für eine Unmenge Arbeitsplätze, von denen dann niemand mehr so recht weiß, ob ihre Besitzer nun zum Kapital oder Proletariat gehören. Während freiheitlich denkende Menschen mit der Wahrnehmung, dass einige Charaktere der bürgerlichen Gesellschaft weder-noch sind, gleich den Gedanken verbinden, dass die Geschichte mit den Klassen allemal zu undifferenziert sei, sind Linke eine Zeitlang mit zwei Fehlern hervorgetreten. Der erste bestand darin, eine Zuordnung zu versuchen, wo nichts zuzuordnen ist. Der zweite leistete sich eine Verwechslung – die von ökonomischer Rolle bzw. Lage mit dem politischen Willen von sozialen Charakteren. Auf diese Weise kamen so absurde Debatten zustande wie die über die produktive und unproduktive Arbeit in der bisweilen streng moralisch über die Revolutionstüchtigkeit von Berufszweigen und Kleinbürgern gerechtet wurde. Inzwischen sind die Teilnehmer dieser Debatten in Amt und Würden, auch bei den Grünen und Frauen, und sie haben ihr Desinteresse an einer Revolution längst gestanden. Immerhin auch ein handfester Beweis, dass Studenten mit ihren Karrieren zur Elite gehören und nicht zu einer schwankenden Zwischenschicht. Die Vorstellung, aus den Berufen, die sie im Staats- und Wirtschaftsauftrag ausüben, könnten mit einigem guten Willen volksfreundliche Einrichtungen werden, ist nur eine verquere und besonders idealistische Weise, Intellektuellen- und Berufsstolz zu pflegen, und hat sich deshalb auch wieder normalisiert.
Beruf: Künstler
Dass Künstler etwas können müssen, was durchaus nicht jeder kann – Noten lesen; richtig Atem holen beim Singen; Meißel oder Pinsel geschickt handhaben; Gesicht und Gestalt glaubwürdig in Falten legen; beim Erzählen einen unterhaltsamen Ton treffen; usw. –, gehört zu den Voraussetzungen ihres Berufs; es macht ihn nicht aus und kann sich sogar, bei ganz echten Künstlern, als eine Einstiegsbedingung erweisen, die im Laufe der Karriere überwunden und verlassen werden muss. Die Solidität des gelernten Handwerks jedenfalls macht erst einmal nur den Orchestermusiker, Gebrauchsgraphiker, Regieassistenten und dergleichen untergeordnetes Personal. Das Künstlertum, auf das deren Ehrgeiz – zumindest in jüngeren Jahren noch – geht, fängt mit der tieferen Bedeutung an, die sie ihrer Ton- oder Farbsetzerei, ihren Drehbüchern oder ihrer Stimme beilegen; und es erfüllt sich mit dem Erfolg, dass das Publikum in Sang und Klang, verklecksten Farben und gestaltetem Metall, literarischen Fiktionen und deren schauspielerischer Vorführung eine Bedeutung sucht und sich im großen und ganzen darüber einig wird, eine bedeutende gefunden zu haben. Für die entsprechende Anleitung des Publikums zu solchem Getue stehen verhinderte Künstler zur Verfügung, die es in keinem Metier zu den nötigen handwerklichen Voraussetzungen gebracht haben und die deswegen rein theoretisch die tiefere Bedeutung ermitteln – oder auch vermissen –, die sonst im schönen Klang und unterhaltsamen Spiel womöglich verlorengehen könnte: die Kunstkritiker.
Kunstkritiker und wahre Künstler sind die Verbündeten im Kampf gegen die banale Wahrheit, dass sämtliche Metiers, die den Kunstbetrieb ausmachen, Anlässe und Gegenstände fürs freie Spiel der Einbildungskraft, also Unterhaltung und Genüsse der Phantasie herstellen und sonst nichts. Dass ihre Werke in der Sphäre des gesellschaftlichen Luxus zu Hause sind, macht sie leiden. Denn „bloße“ Handlanger des Vergnügens wollen sie nicht sein – als wäre das im Zeitalter Frank Elstners und der Eurovisions-Schlagerkonkurrenz nicht schon eine ganze Menge. Doch ausgerechnet die Verhöhnung jedes Unterhaltungsbedürfnisses durch Shows der Doofheit und nationalistisch verseuchtes Geträller, durch Krimis ohne Spannung, dafür mit meterdick aufgetragener Moral usw. gilt nach einer wahrscheinlich von Kunstkritikern erfundenen Unterscheidung als U wie Unterhaltung, während der Kunst ein E wie Ernst gebühren soll. Benannt ist damit jedenfalls das Vorurteil, auf das die Macher, Vertreter und Anwälte der Kunst Anspruch erheben. Verlangt ist der Wille, sich von den fraglichen Produkten über gewisse gar nicht alltägliche Sinnfragen belehren zu lassen und anschließend eine Haltung einzunehmen, als würde man „etwas“, nämlich mindestens so etwas wie eine ganz neue Erkenntnis, „mit nach Hause nehmen“ – wie nach einem Gottesdienst.
Denn Dienst will die Kunst schon sein: an etwas höchst Erhabenem nämlich, in das sie dem Publikum Einblick gewährt – und zwar tiefen und durch kein ‚bloß rationales‘ Denken und Argumentieren zu ersetzenden Einblick. Die Frage: In was denn, um Gottes willen? Würde tiefsten Kunstunverstand offenbaren. Falsche Abstraktionen wie ‚das Leben‘, ‚das Schicksal‘, ‚das Tragische‘ usw. sind allemal im Spiel; vor allem aber darf man den „ernsten“ Gehalt nie so aussprechen, dass die dürren philosophischen Tiefsinnigkeiten peinlich offenbar werden, die sich dazu allenfalls denken lassen. Der Kunstkritiker muss schon sehr demonstrativ um Worte ringen, um deutlich zu machen, dass eben die Kunst und sie allein die Sprache des Unsäglichen ist; und das Publikum muss seinen „Sinn für Kunst“ schärfen, nicht um seinen Genuss zu steigern, der mit einer Kenntnis und Wiederentdeckung des Kontrapunkts oder des goldenen Schnitts allenfalls verbunden sein mag, sondern um der Botschaft des „Unaussprechlichen“ teilhaftig zu werden, das der gar nicht herausgehörte Kontrapunkt usw. Ihm zu „sagen haben“ soll. Kunst ist eben gelungen, wenn das Publikum sich, unter kritisch-kundiger Anleitung oder auch ohne, die Disziplin auferlegt, sich von dem Dargebotenen an seine krude sonntägliche Lebensphilosophie erinnern zu lassen.
Fragt sich nur, was der Künstler eigentlich tun kann für diesen Effekt. Denn für ihn ist es – im Unterschied zum Publikum – zu wenig, den Gestus tieferer Bedeutsamkeit methodisch vor sich her zu tragen; so unbesehen nehmen die kritischen Sachverständigen und die Gemeinde nun auch wieder nicht die Absicht für die Tat. Ein bisschen Überzeugungsarbeit muss schon geleistet sein, bis am Ende auch noch eine schmutzige Badewanne als Kunstwerk durchgeht. An Endergebnissen dieser Art wird andererseits nur noch einmal besonders deutlich, dass der Weg zu anerkanntem Künstlertum jedenfalls nicht über eine immer weitergetriebene Perfektionierung des Handwerklichen geht – da hat sich sogar ein Thomas Mann eine Zeitlang die urdeutsche Einordnung als „bloßer“ Schriftsteller im Unterschied zum wahren und eigentlichen Dichter gefallen lassen müssen.
Um den Rang eines anerkannten Künstlers zu erreichen, muss der Unterhalter seinen höchstpersönlichen Trick finden, um den hohlen Gestus der tieferen Bedeutung, die man sich nicht selber ausgedacht, sondern als Botschaft und Auftrag empfangen hätte, dem Unterhaltungswerk einzuprägen. Dabei lässt sich der Umstand ausnutzen, dass weltanschauliche Botschaften sich mit Genuss und Unterhaltung logisch wie wirklich nicht vertragen. Umgekehrt wird so etwas wie ein Rezept daraus: Das dargebotene unterhaltsame Spiel der Einbildungskraft zu (zer-)stören, kann den Anschein rüberbringen, dass der Künstler es irgendwie fürchterlich ernst meint mit seinem Opus. Was Brecht als Beendigung des schöngefärbten künstlerischen Luxus und Übergang in den Ernst des wirklichen Lebens, d. h. einer praktisch wirkenden Erkenntnis gemeint hat, die „Verfremdung“, erfüllt nicht bloß in seinen Werken den Tatbestand eines dramaturgischen Kniffs; so etwas ist überhaupt der Kunstgriff der Kunst.
Der fällt natürlich je nach Metier anders aus und auch unterschiedlich schwer. Bei der Reproduktion von Kunstwerken fällt das Künstlertum, das schöpferische, das die handwerkliche Könnerschaft überschreitet, so ziemlich mit den Allüren zusammen, die eine Souveränität der aufführenden Mannschaft resp. Ihres Regisseurs oder Dirigenten gegenüber den vorliegenden Noten oder Texten demonstrieren; und man kann froh sein, wenn diese Kunst das Werk nicht vollends ungenießbar macht. Bei der Anfertigung neuer Beiträge zur Kunstgeschichte bietet der amorphe Stoff – Wörter, Töne, Farben, Striche usw. – einerseits mehr Freiheiten, für Ungenießbarkeit zu sorgen; da liegt die Schwierigkeit eher darin, dass immerhin noch so etwas wie eine Erzählung, ein als solches identifizierbares Stück Musik, ein zur Betrachtung geeignetes und womöglich reizendes Werk usw. Herauskommen muss, mit dem die Kunstgemeinde sich befasst. Denn deren Kunstverstand ist im Normalfall ja doch noch mehr die Heuchelei, die ein gebildetes Unterhaltungsbedürfnis überhöht, und nur ausnahmsweise ein Wahn, der dieses ersetzt. So bleibt dem Künstler, der sich im Interesse seiner unsäglichen Botschaft von allem Überkommenen befreit, immer noch das zu seinem Metier gehörige Leid erhalten, ein ihm gar nicht adäquates, mit schlechtem Geschmack ausgestattetes Publikum unterhalten zu müssen, damit er es zu den angepeilten Erbaulichkeiten verführen kann.
Nach einem Numerus clausus, den keine staatliche Instanz verhängt – sogar mit öffentlichen Beförderungen durch Staatsaufträge und -preise schließen sich demokratische Obrigkeiten meist dem Urteil des kunstverständigen Publikums an –, kommt es dann doch in jeder Branche zu dem notwendigen Quantum kunstschaffender Elite, die für die heimische Kulturnation Ehre einlegt. An ehrgeizigem Nachwuchs fehlt es ohnehin nicht für die unendliche Fortführung des lächerlichen Schauspiels, dass die Produzenten der freiesten und luxuriösesten Unterhaltung sich dabei allen Ernstes an der Verfertigung der Botschaft abarbeiten, sie würden sich gerade – mit den Mitteln der Phantasie und ihrer Genüsse – an den wichtigsten weltanschaulichen Sinnfragen abarbeiten. So kommt immerhin jeder Beteiligte auf seine Kosten: die Sinnfrage die im Getue der Kulturaffen tatsächlich am besten und angemessensten aufgehoben ist; das Publikum, das nicht einmal seiner Phantasie einen Spaß gönnen will, auf den es sich nicht durch moralische Grübeleien ein Recht erworben hat; die Kunstkritiker, die jeder Regung ihrer Deutungsanreger einfühlsam nachspüren und dem Publikum von Theaterereignissen vorschwärmen und entzauberte Tonwunder zu Gemüte führen, so dass sich die große Mehrheit glatt jeden Kunstgenuß sparen kann – sie hat ja durch den Kulturteil der Zeitungen lebendigen Anteil am Kulturbetrieb; der Staat, der sich durch diesen Betrieb mit der Lüge schmückt seine Gewalt gründe auf Geist, Sinn, Moral und anderen erhabenen Dingen – und nicht umgekehrt; und natürlich die Künstler. Die konkurrieren mit ihrem Leiden am Zwiespalt zwischen Scherz und Ernst; kokettieren damit und dementieren natürlich, dass sie auf den Beifall scharf sind, von dem sie abhängen, obwohl doch allemal eine Berufung höherer Art sie ereilt hat. Und in den reichlich fließenden Fördermitteln, die eine nationalkultur-beflissene Herrschaft ihnen zukommen lässt, entdecken sie manchen Anschlag auf die Freiheit, die wahre, künstlerische nämlich, weil die ministeriellen Auftraggeber bei manchem gewollt originellen und gewagten Phantasieprodukt glatt die rechte Botschaft vermissen und den Geldhahn zudrehen. Dann ist für die allerfreiesten Staatsdiener regelmäßig die Demokratie und das Abendland in Gefahr, die schließlich dazu da sind, Künstler der schnöden Alltagssorgen und des plumpen Massengeschmacks zu entheben, so sie nicht gerade für den karajanen, derricken oder siegeln.
Wenn andererseits die Selbstmordquote bei den Kulturbeuteln sich im Rahmen hält, dann lässt sich daraus die beruhigende Gewissheit schöpfen, dass das gesunde bürgerliche Verhältnis Zwischen Sinn-Heuchelei und materieller Berechnung auch bei den professionellen Exzentrikern der bürgerlichen Gesellschaft im großen und ganzen in Ordnung ist.
Beruf: Lehrer
Lehrer unterrichten Kinder und Jugendliche. Sie bringen ihnen Lesen und Schreiben, Rechnen und fremde Sprachen, anständiges Benehmen und Erdkunde, Turnen und andere Dinge bei. Eine klare Sache. Bleibt nur noch eine offene Frage: Wozu taugt der Lehrerberuf?
Es gehört zum Berufsbild des Lehrers, dass er auf diese dumme Frage keine Antwort weiß. Die subjektiv ehrliche Auskunft: „Um mit relativ wenig Aufwand einen relativ sicheren und angenehmen Lebensunterhalt zu verdienen!“ ist eine Ausflucht, weil sie sich um den Zweck des Berufs herumdrückt, Mit dem da ein Gehalt zwischen A 12 und A 15 verdient wird. Und die scheinbar so naheliegende Antwort: „Um den Kindern und Jugendlichen etwas Nützliches beizubringen!“ steht nicht ohne Grund in dem Verdacht, eher einen etwas weltfremden Idealismus wiederzugeben als die Sachlage.
Einen eindeutigen Nutzen für die Schüler hat das Unterrichten tatsächlich nur im Hinblick auf den Zweck, den überhaupt erst die Schule ihren Besuchern vorgibt und ganz unabhängig von deren Interessen und Vorhaben als Pflicht auferlegt: im Hinblick auf den Schulerfolg, die Versetzung in die nächste Klasse und ein ansehnliches Abgangszeugnis am Ende. Mit dem Nutzen des Unterrichts für dieses Ziel ist es zwar so eine Sache; denn oft machen die Methoden eines Lehrers manchem Schüler bei der Verfolgung dieses schulimmanenten Zwecks mehr Schwierigkeiten, als dass sie ihm helfen. Das ändert aber nichts daran, dass der Schulunterricht im Prinzip Mittel und Zweck in einem ist: Lehrer bringen ihren Schülern die verschiedensten Dinge bei, um in Form von Zensuren ein Urteil darüber zu erstellen, mit welchem Erfolg jeder einzelne ihrem Unterricht beigewohnt hat – eine reichlich zirkuläre Angelegenheit.
Schulmeister fordern also den Verstand der Schüler. Der soll sich gewisse Elemente der gesellschaftlich erarbeiteten und benutzten Naturerkenntnis aneignen, Geschichtsereignisse und Vokabeln fremder Sprachen im Gedächtnis behalten, die wichtigsten und beliebtesten ideologischen Abstraktionen, Beweisverfahren und Schlussfolgerungen kennen und frei anwenden können und vieles andere mehr. So machen die Lehrer den Nachwuchs klüger – und nicht nur das. Sie verlangen von ihren Schülern und geben ihnen im Unterricht dauernd Gelegenheit dazu, sich auszuzeichnen oder auch öffentlich zu versagen. Verstand ist gefragt, damit die belehrten Individuen sich bei seiner Betätigung und Vorführung erkennbar unterscheiden.
Dieser eigentümliche Verstandesgebrauch ist – bei aller Allgemeinheit des „Stoffs“ – ein reines Kunstprodukt der Schule für die Schule, das außerhalb dieses geschlossenen Kreislaufs überhaupt nur in einem Zusammenhang nützlich anzuwenden ist, nämlich als Waffe der privaten und bisweilen auch der öffentlich-demokratischen Angeberei. Die unterschiedlichen Erfolge der einzelnen in dieser Kunst bewertet und verbucht der Lehrer als individuelle Verstandesleistung, die dem einzelnen aber als die Äußerung seines intellektuellen und moralischen Leistungsvermögens zuzurechnen sei. Das so „ermittelte“ Vermögen des Schülers wird in Zensuren beziffert und gibt damit den praktischen Leitfaden – und ganz gratis daneben auch noch die ideologische Rechtfertigung – für die Entscheidung her, auf die es in der Schule ankommt: für den jährlichen Beschluss, die Besseren vorrücken zu lassen, den geistig weniger „Vermögenden“ dagegen die Last weiterer Ausbildung zu ersparen und auf diese Weise die „ermittelten“ geistigen Vermögensunterschiede zu vergrößern. Ein mit den Jahren wachsender Teil jedes Jahrgangs wird so systematisch von der Betätigung des Verstandes überhaupt, einschließlich aller Elemente des Wissens und Sich-Auskennens, an die ein Bürger moderner Kulturnationen kaum anders als durch die Schulpflicht herankommt, ausgeschlossen.
Diese Negativität und eigenartige Selbstbezogenheit des Schulunterrichts bleibt dessen Funktionären nicht verborgen. Die Form allerdings, in der sie sich das eingestehen, ist das Dementi – das doch so verräterisch ist wie noch jedes Dementi. Kein Lehrer, der nicht in etlichen Variationen den alten lateinischen Lehrsatz vertritt, als Schüler lerne man, gefälligst, für „das Leben“ und nicht etwa bloß für die Schule. Nur: Wer muss das wohl beteuern?
Im Unterricht kommen gute Lehrer ihren Schülern mit verschiedenen methodischen Nutzanwendungen besagten Grundsatzes, in welche die Lehrerausbildung sie eingeübt hat. Moderne Pädagogen postulieren einen bruchlosen Zusammenhang zwischen dem Unterrichtszweck und den Bedürfnissen der Schüler – und beweisen mit ihren Bemühungen, diesem Postulat zu entsprechen, doch nur, dass weder die wirklichen bornierten Interessen der lieben Kleinen noch der vernünftige Zweck, die Mittel und Bedingungen der Eigenen Existenz zu beherrschen, und dafür zuerst einmal zu begreifen, mit der Abstraktion des Schulerfolgs zusammenstimmen.
- Die Kleinsten möchte ein guter Lehrer am liebsten spielerisch in die „Welt der Zahlen und Buchstaben“ einführen, gerade so, als ergäbe das Rechnen und Schreiben sich von selbst aus dem kindlichen Spielbedürfnis, wenn man die dazugehörige Disziplin des Denkens hinter bunten Farben und „lustigen“ Figuren versteckt. Das hartnäckig praktizierte Ideal des „kindgemäßen Lernens“ verleugnet unverdrossen den durchaus rationellen und unausbleiblichen Gegensatz, in dem die Inanspruchnahme des Verstandes allemal zur Hingegebenheit an Phantasie und Spielzeug steht, und verrät damit, dass die Lehrer hier einen ganz anderen Gegensatz „bewältigen“ als den sachlichen zwischen Verstandestätigkeit und Spielerei, der sich von selbst auflöst, sobald das Kind überhaupt den Übergang macht von seinen Launen zum Interesse, vom Spiel der Einbildungskraft zum Nachdenken. Sie wollen die Schulanfänger in die Verfolgung des Unterrichtszwecks hineinbetrügen, sie mit Kindereien zu Schulleistungen verführen, damit sie am Ende garantiert kindgerecht benoten können, inwieweit jedes einzelne Kind mitgemacht und Leistungen erbracht hat.
- Von demselben Widerspruch sind die schulmeisterlichen Anstrengungen geprägt, ältere Schüler zu einem selbstzweckhaften Interesse am Unterrichtsstoff zu verleiten. Der Wille, den Jugendlichen die Welt zu erklären, die maßgeblichen gesellschaftlichen Interessen vor allem, die über ihr weiteres Dasein entscheiden, ist da nicht am Werk; so etwas ist schon im Lehrplan nicht vorgesehen, von dem alle Bemühungen um eine „Motivation“ der Schüler ausgehen und auf dessen Erfüllung sie hinzielen. Auch wäre da ein Gegensatz zu den Ideologien fällig, die schon Kinder sich hierzulande einleuchten lassen, und nicht Anbiederei. Lehrer dagegen tun ihr Bestes, um ihre Schüler zur Anteilnahme am vorgeschriebenen Stoff zu verlocken. Dafür bemühen sie die dümmsten Bildungsideale: vom unabsehbaren Nutzen einer „musischen Bildung“; von der „Schulung der Denkfähigkeit“ ausgerechnet durch Mathematik und Latein, die vor allem außerhalb dieser Fächer zu Erfolgen verhelfen soll; von der Unentbehrlichkeit eines „Geschichtsbewusstseins“ für eine gerechte Einstellung zum Weltlauf … Dabei sind die bestgemeinten Appelle an ein nicht berechnendes Bildungsbedürfnis davon diktiert, dass der Schulunterricht eben nicht mit einem vernünftigen Wissensdurst der Schüler rechnet und noch nicht einmal mit einem verkehrten Bildungsidealismus, sondern dass er auf ein berechnendes Interesse am Schulerfolg zählt. Zum Zwang der Zensuren, der dieses schnöde Verhältnis zum „Stoff‘ durchsetzt, passt umgekehrt das Ideal des an und für sich erstrebenswerten „Bildungsguts“, das keinem wirklichen Interesse als Mittel dient, ebenso wie der Stolz, mit dem noch jeder Lehrer auf vereinzelte Schülerexemplare verweisen kann, die sich „wirklich interessiert“ gezeigt hätten …
Die Basis, auf der Lehrer und Schüler sich wirklich treffen, sind am Ende allemal die Zensuren. Die Lehrer bringen die „Sachzwänge“ des Schulerfolgs ins Spiel, um den es schließlich geht, und die Schüler stellen sich drauf ein. Selbst da leisten Lehrer sich allerdings gerne noch ihren pädagogischen Schwindel. Die einen interpretieren das gesamte Notenwesen als ein pädagogisches Verbrechen, das jeden ehrlichen Bildungseifer der Schuljugend von Anfang an kaputt – und ihnen das Leben schwermache – so als wäre es nicht umgekehrt die Geschäftsgrundlage ihres beruflichen Einsatzes. Die anderen, die allermeisten, möchten die Zensuren, ihre zumindest, als hilfreiches Auskunftsmittel für die Schüler über deren individuellen Leistungsstand gewürdigt wissen – so als wäre dieser noch etwas anderes als das in den Zensuren niedergelegte Urteil über sie. So oder so: Dass der Zweck ihrer Tätigkeit sich in der Zuteilung von Schulnoten erfüllt, das wollen Lehrer, bei aller „Illusionslosigkeit“, denn doch nicht wahrhaben; das wird kräftig geleugnet – und gerade so eingestanden.
Immerhin haben die Lehrer in letzter Instanz die fraglose praktische Bedeutung auf ihrer Seite, die der Schulerfolg fürs Berufsleben besitzt. Dieser Nutzen des Unterrichts „fürs Leben“ ist unbestreitbar – hat eben darin aber seinen Haken. Er fällt nämlich keineswegs zusammen mit einer sachlichen Zweckdienlichkeit des bewältigten Unterrichtsstoffs für berufliche Konkurrenz und Karriere. Sicherlich sind Lesen, Schreiben und Rechnen elementare Voraussetzungen fürs Geldverdienen und staatsbürgerliche Pflichterfüllung. Wo das allerdings die einzig nennenswerten überdauernden Bildungsleistungen des Schulunterrichts bleiben, da darf man schon gar nicht mehr fragen, ob der Erwerb dieser großartigen Fertigkeiten sich für die Schulabgänger in ihrem Arbeitsleben jemals lohnt. Aufsässige Schüler fragen das ja bisweilen – und kündigen damit ihre Bereitschaft zu sachgerechter Unterrichtsteilnahme auf; denn sie können sich sicher sein, dass kein Lehrer ihnen einen solchen Vorteil nachweisen kann. Die Lohnarbeit, die mit einem solchen Mindestmaß an Verstandeskultur zu bewältigen ist, ruiniert ihre Leute, übrigens einschließlich aller Verstandeskräfte; Menschen dazu zu „befähigen“, kann kein Schulunterricht im Ernst zu seinen Ruhmestaten zählen.
Höhere Schulbildung ist da von höherem Nutzen; das steht außer Frage. Allerdings steht das eben deswegen außer Frage, weil es auch da nicht auf die sachliche Zweckdienlichkeit des Unterrichts fürs berufliche Wirken ankommt, sondern weil bessere Schulerfolge als formelle Einstiegsbedingungen für bessere Berufslaufbahnen festgelegt sind. Kein Personalchef fragt je nach Literaturkenntnissen oder Kunstverstand, nach Schulkenntnissen in Fremdsprachen oder Physik, nach Geschichtsbewusstsein oder mathematischen Kurvendiskussionen, also nach den Künsten, Fertigkeiten und Wissensbrocken, deren gute schulische Benotung andererseits unerläßliche Einstellungsvoraussetzung ist. Und selbst wenn ein Personalbeamter doch vielleicht einmal an solchem Stoff die Selbstdarstellung eines Bewerbers auf die Probe stellt: Der so erreichbare Beruf fordert weder Bildbeschreibungen noch Besinnungsaufsätze, geschweige denn dilettantische Chemie-Experimente oder Gesangskünste. Es bleibt den privaten Bildungsideologien der Schulmeister sowie dem Erfindungsreichtum der „empirischen“ pädagogischen „Forschung“ überlassen, tiefere inhaltliche Entsprechungen zwischen bewältigten Unterrichtsstoffen und beruflichem Fortkommen zu „ermitteln“, und nach Geschmack darf jeder sich darüber wundern oder daran freuen, dass manches später anerkannte Genie in seiner Schulzeit als Versager durchgelaufen ist und Musterschüler in beruflicher Mittelmäßigkeit versacken.
Lehrer liegen demnach gar nicht so falsch, wenn sie bisweilen von dem Verdacht beschlichen werden, sie seien Funktionäre einer selbstzweckhaften, vom normalen „gesellschaftlichen Leben“ ziemlich gründlich abgetrennten „Welt für sich“. Doch haben sie auch damit nicht recht; schon gar nicht, wenn sie diese Abtrennung als günstige pädagogische Bedingung und „Freiraum“ schätzen oder umgekehrt nach mehr „Lebens-“ und „Praxisnähe“ seufzen. Ihr Job wirft seinen Nutzen für „das Leben“ genau dadurch ab, dass er nach schulinternen, sonst nirgends gültigen Maßstäben mehr oder weniger erfolgreiche sowie erfolglose Absolventen herstellt und damit jedem Individuum seinen höchstpersönlichen Einstieg in die Welt des Geldverdienens verpasst, die sich als weitgefächerte Hierarchie höchst unterschiedlicher Chancen darstellt. Dieses „Leben“ bedienen die Schulmeister mit einem Menschenmaterial, das getrennt davon und gerade so sehr passend und zweckmäßig hierarchisiert ist. Sie vergleichen die Individuen nach einem neutralen, unanfechtbar gerechten Kriterium jenseits aller Härten des Berufslebens und der ökonomischen Konkurrenz: nach dem Maßstab der „intellektuellen Leistungsfähigkeit“; und gerade so organisieren sie den Nachschub für sämtliche Arbeiten und Posten, die in einer modernen Klassengesellschaft anfallen.
Dass dieses Kriterium der intellektuellen Leistungsfähigkeit eine in sich widersprüchliche Fiktion ist, stört niemanden. Dass es so nur in der und für die Schule gilt, ist gut und nicht schlecht; denn das garantiert gerade den Schein, da würde einzig und allein das Individuum nach seiner geistigen Ausstattung und Einsatzbereitschaft gewürdigt. Dass eine spezielle Brauchbarkeit für spezielle Berufe dabei höchstens zufällig herausschaut, ist kein Mangel; denn entweder erzwingt die Arbeit selbst das Nötige, oder die „fachliche Qualifikation“ erfolgt nach Beendigung der allgemeinen Schulpflicht. Sache des Schulunterrichts ist es, ausgerechnet mit den ihrer Natur nach nicht-exklusiven „Gütern“ der Allgemeinbildung das praktische Bedürfnis der demokratischen Klassengesellschaft nach einer Hierarchisierung ihres Menschenmaterials zu erfüllen und zugleich den Schein zu erzeugen, genau so würde jedem einzelnen seine höchstpersönliche Chance für eine ihm gemäße Selbstverwirklichung eröffnet.
Diesem Schein sind sämtliche kritischen Bedenken verpflichtet, die einem Lehrer bei der treuen Erfüllung seiner Berufspflichten unweigerlich einmal durch den Kopf gehen. An Umständen und Bedingungen, die das Ideal einer grundgerechten Sortierung des Nachwuchses in der Praxis beeinträchtigen, herrscht ja kein Mangel; und es liegt in der Natur der Sache, dass in dieser Hinsicht jede Errungenschaft ihre zwei Seiten hat, so dass das „Problem“ garantiert erhalten bleibt. Die einen stören sich am „Bildungsvorsprung“, den die Kinder beflissener „Mittelschicht-Eltern“ schon ins erste Schuljahr mitbringen, sowie am Nachhilfeunterricht und den guten Beziehungen zum Lehrkörper, mit denen „bessere“ Familien dem Schulerfolg ihrer Sprößlinge Beine machen. Sie fordern „Chancengleichheit“ und zu diesem Zweck eine Extraförderung von „Unterschicht“-Kindern, was wiederum die Gegenseite als Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes kritisiert. Die befürchtet außerdem sowieso eine Nivellierung der schulischen Leistungen nach unten, missversteht absichtsvoll „Chancengleichheit“ als ,,Gleichmacherei und plädiert für mehr Hierarchie – „nicht zuletzt“ im Interesse der Schulversager, deren Individualität mit ganz wenig Unterricht viel besser zu entsprechen wäre. Und so weiter. „Reaktionäre“ wie „fortschrittliche“ Zweifel an der Gerechtigkeit der tatsächlichen Sortierungspraxis der Schule beruhen auf dem Schein, um nichts als gerechte Kindgemäßheit wäre es dem Schulwesen zu tun, und bemühen sich konstruktiv um dessen Glaubwürdigkeit.
Das bisschen Wissen, das der Schulunterricht für die Hierarchisierung der Jugend mit heranzieht, könnten die Kinder sich zweifellos besser ohne Schulmeister aneignen, die es ausgerechnet auf Unterscheidung der schulpflichtigen Einzelpersönchen abgesehen haben. Um aber jeden neuen Jahrgang in der Falle des Lernens für den Lernerfolg zu fangen, ihn bedarfsgerecht zu sortieren und das als Bildungsangebot zwecks Ermittlung des individuellen Denk-Leistungsvermögens durchzuexerzieren, dafür braucht es akademisch geschultes hauptamtliches Personal: Funktionäre, die lieber nicht so genau wissen wollen, wozu es sie eigentlich gibt.
Beruf: Manager
Unter den Nazis hießen sie noch „Betriebsführer“, Betonung auf Führer, und sollten das deutsche Proletariat zu einer schlagkräftigen Arbeiterarmee, Betonung auf Armee, organisieren. Da ist der amerikanische Name doch viel ziviler und wird der Sache besser gerecht. Er legt die Betonung schlicht darauf, dass gefälligst alles klappen soll: auf den Erfolg.
Ein seltsamer Beruf: Erfolg haben!
Wobei? – das versteht sich von selbst. Zwar kann sich heute jeder dahergelaufene Sportsfreund „Manager“ nennen, sobald ein Sportclub ihm die Sorge um den Erfolg des Vereins anvertraut. Aber selbst da bleibt noch ziemlich deutlich, um welche Sache es beim Managerberuf eigentlich geht. Reichtum soll sich mehren den seine Eigentümer zu diesem Zweck geschäftsmäßig anlegen. Voraussetzungen und Mittel dieses Erfolgs liegen allesamt in dem schlichten Umstand beschlossen, dass in der zivilisierten Welt von heute alles käuflich ist. Für Geld ist jeder Geschäftsartikel zu haben: Produktionsmittel und Lohnarbeiter, Rohstoffe und Absatzwege, Grund und Boden für die nötigen Räumlichkeiten, Läden, Verkäufer und Werksschützer … Umgekehrt haben Arbeiter und Grundbesitzer, Fabrikanten und Händler nur eine erlaubte Chance auf dieser Welt: dass sie das Ihre – Gebrauchsgüter, Rohstoffe, Boden, Arbeit … – als Geschäftsmittel feilbieten und an jeden verkaufen, der mit genügend Geld eine lohnende Geschäftstätigkeit in Gang setzen will. Geld ist der Ursprung und der Zweck aller ökonomischen Tätigkeit in der Freien Welt, und Geld ist das notwendige, aber auch hinreichende Mittel dafür.
Geld ist sogar selbst ein käufliches Geschäftsmittel. Als solches heißt es Kredit, sein „Kaufpreis“ ist der Zins. Kredit wird als das Geschäftsmittel, das alle materiellen Mittel des Geschäfts verfügbar macht, vergeben, wenn das Geschäft, dem er dient, Erfolg verspricht; und dieses „Versprechen“ geht um so sicherer in Erfüllung, je mehr Reichtum dafür verfügbar gemacht wird. Für den Verleiher ist das Verleihen selbst das Mittel, das hergeliehene Geld vermehrt zurückzubekommen. Eine Geschäftemacherei, die mit ihrer materiellen Grundlage – der Käuflichkeit aller Produktionsmittel und der Einrichtung eines lohnenden Produktions- und Absatzwesens – nur noch ganz indirekt zu tun hat.
Inhalte und Ziele des Managerberufs sind damit bereits aufgezählt. Er ist dazu da, dass die Funktionen praktisch vollführt werden, die dem Geld als Geschäftsmittel, also als Grund und Mittel seiner Vermehrung innewohnen. Dieser Dienst am Geld trennt sich vom Besitz des Geldes, der Produktionsstätten und Produktionsmittel, kurz: der Mühsal des Eigentum-Habens, spätestens da, wo der geschäftsmäßig fungierende Reichtum die Zusammenfassung von Teilen vieler privater Geldvermögen ist, heutzutage meist in der Form von Aktiengesellschaften.
Der Erfolg solchen Dienstes ist naturgemäß grundsätzlich so groß wie der Reichtum, der angewandt wird – übrigens auch der private Erfolg der beschäftigten Funktionäre, zumindest der besseren: Deren Gehalt ist ein nicht unwichtiger Ausweis für Umfang und Erfolg des Unternehmens, das sie managen. Dass diesem Lohn eine Leistung entspräche, ist ein ebenso absurder wie in Ehren gehaltener Schein, der seinen Grund in der einzigen Schwierigkeit hat, auf die das Geschäftemachen in einer ordentlichen kapitalistischen Gesellschaft trifft: in der Konkurrenz. Es sind ja viele Firmen, die die Vergrößerung des in ihnen angelegten Reichtums betreiben; und die machen sich mit Notwendigkeit das Leben schwer. Denn jede will Geld verdienen; nicht um es zu verjubeln, sondern um ihre „Basis“: Masse und Wucht des engagierten Geldvermögens, dauernd zu vergrößern. Das geht aber nicht ohne Kampf um Märkte und Marktanteile durch die Verbilligung der Produktion, also nicht ohne Einschränkung des Umsatzes und damit des Geschäftserfolgs anderer Firmen. Umgekehrt machen die Angriffe der Konkurrenten für jede Firma ihre Vergrößerung zur Überlebensbedingung. Ein Reichtum nämlich, der sich – „auf dem Markt“, wie man so sagt – nicht durchsetzt, bleibt bekanntlich nicht als bescheidenes stilles Vermögen erhalten, sondern geht zugrunde. Womit kein konkurrenzfähiges Geschäft zu machen ist, es mögen noch so nützliche Waren, Produktionsanlagen oder darauf lautende Schuldscheine sein, das ist eben deswegen auch kein Reichtum mehr, erweist sich vielmehr beim Konkursrichter als aufgeblasenes Nichts.
Alle Manager treiben dasselbe: Sie bedienen das Geld. Der Witz dieses simplen Funktionärstums liegt jedoch darin, dass sie es gegeneinander betreiben. Das ist der Stachel ihres Erfolgs: Das macht ihn erstens notwendig und zweitens unsicher. Konkurrenzkampf eben, mit Betonung auf Kampf. Damit wird aus dem bloßen Funktionärstum eine Charakterfrage. Billiger einkaufen; beim Verkaufen Marktanteile erobern; dafür die Stückkosten senken, also die Arbeit produktiver machen – was einen kompletten Klassengegensatz bedeutet, ohne dass Manager das zu wissen brauchen –; günstige Kredite an Land ziehen und die Kreditwürdigkeit der Konkurrenten in Verruf bringen; durch Schmiergeldeinsatz Aufträge ergattern; Absprachen treffen und brechen; alle Chancen zur Spekulation ausnutzen und die Konkurrenz beim Spekulieren reinreiten; und als Universalmittel dafür: die nötigen Leute, die bei alldem mitzuspielen haben, kennen, einseifen und erpressen: Darin muss ein Manager Könner sein.
Bloß: Was kann man da schon können? Der Einblick in die verschiedenen Geschäftsabteilungen, Sachkenntnis im Dienst am Geld, ist für den Konkurrenzerfolg eines Managers eine bloße, längst nicht hinreichende Voraussetzung. Skrupellosigkeit, gepaart mit dem Schein von Ehrlichkeit und Solidität, ist gleichfalls notwendig, aber für nichts eine Gewähr. Wer mit dem Geld, das er hat, und dem Geschäft, das er vorhat, nicht prächtig angeben kann, der braucht das Managen gar nicht erst anzufangen; Erfolg beim Angeben ist aber noch kein Erfolg am Markt. Und immer wieder stellt sich heraus, dass die Anwendung haargenau der gleichen Methoden, Charakterstärken und Geldsummen mal Erfolg bringt, mal an den Gegenzügen der Konkurrenten scheitert. Man, und vor allem der Betroffene selbst, weiß allemal erst hinterher, ob einer ein guter oder ein „Miss“-Manager ist. Hat er Misserfolg, so darf ihm jeder – von den Wirtschaftsjournalisten des „Spiegel“ angefangen – haltlose Spekulation, verfehlte Unternehmenspolitik, Einstellungen und Entlassungen der falschen Leute und am falschen Ort, unsolide Kreditaufnahme bzw. -Vergabe, verkehrte Geschäftsfreunde, übertriebenen Aufwand, kurz: alles und genau das als Missgriff ankreiden, was bis dahin den Ruf als geschickter, wagemutiger, kenntnisreicher usw. Geschäftsmann ausgemacht hat. Erfolgreicher Manager wird man eben bloß dadurch, dass man Konkurrenten ausbootet und es wird. Diese Dummheit liegt in der Natur des Jobs. Aus ihr speisen sich die Ideologien des Berufs ebenso wie seine Ausbildungsvorschriften.
Die Berufsideologie adelt den Erfolg bei der Ausnutzung einer Firmenbelegschaft zur „Führungsstärke“; den unberechenbaren Erfolg geschäftlicher Berechnungen deutet sie als „Spürnase“ oder ähnliche Symptome unerforschlicher Weisheit; Erfolge beim Intrigieren ehren den Manager als „eindrucksvolle“ und „durchsetzungsfähige Persönlichkeit“. Die Tatsache einer Karriere gilt als Beweis dafür? Dass es sich um einen „Erfolgsmenschen“ handelt, also umstandslos als ein einziges und als größtes Kompliment. Danach richten sich dann auch die Bezüge; so wird eine Ideologie zum Gehaltskonto.
Eine vorbereitende Ausbildung ist der Natur der Sache nach im Grunde gar nicht möglich. Die paar Kenntnisse in Buchführung und Produktionsplanung, die ein Jung-Manager mitbringen muss, gelten zu Recht als nebensächliche Voraussetzung, die jede Sekretärin im Grunde genauso gut beherrscht; zu lernen sind sie, bei gemütlicher Zeiteinteilung, in drei Wochen. Die acht oder mehr Semester BWL-Studium sind dennoch nicht für die Katz. Die Ideologie vom Managen als Könnerschaft verlangt einfach nach der Bürde und Würde akademischer Prüfungen; wo bliebe sonst der Schein der beruflichen Leistung in unserer „rationalen“ bis „verkopften“ Gesellschaft. Außerdem kann der Nachwuchs in der Zeit beweisen, dass er seine Zeit zu nutzen versteht. Die Techniken, sich als Erfolgsmensch zu präsentieren, lassen sich unter gleichgesinnten Kommilitonen und -innen auch ohne Firma ganz gut einüben. Und sie sind nicht einmal eine ganz brotlose Kunst, weil man so schon Leute kennenlernen und Leuten auffallen kann, auf die es später mal ankommt bei der Karriere. Schließlich kann nicht jeder BWL-Student später auch wirklich Manager werden, so dass es wo der richtige Vater fehlt – auf das Geschick ankommt, den eigenen Aufstieg zu mänädschen. Studieren, um in die richtige Verbindung einzutreten – das ist zwar bescheuert genug, aber auch ein Studienzweck. Und geistloser als ein Philosophiestudium ist diese Karrierephilosophie auch nicht.
Beruf: Naturforscher
Im ganz Großen und im besonders Kleinen bietet die Natur dem entdeckungsfreudigen Menschengeist durchaus noch manches Unerforschte – auch wenn es sicher in die Sphäre der verlogenen Schwärmerei gehört, dass jede „Antwort“ bloß um so mehr „neue Fragen“ aufwerfen würde; die Zahl der „Welträtsel“ hat sich schon beträchtlich reduziert, und vor allem haben heutige Naturforscher ein weitgehendes Wissen von den Gegenständen, die sie unter die noch nicht erkannten zählen. Auch in den Größenordnungen zwischen den Massenberechnungen für Sternnebelhaufen und denen für Neutrinos gibt es aber für naturkundlichen Forscherehrgeiz viel zu tun. Was aus dem Klima im Großen und Besonderen wird, wenn der Kohlendioxidanteil in der Luft weiter zu- und der weltweite Baumbestand abnimmt; wie giftig die industriell produzierten Gifte sind und für wen, und wo sie letztlich bleiben; ob Salzstöcke die Lagerung größerer Mengen Plutoniumabfall einige Millionen Jahre lang verkraften und wie: Eine Fülle funkelnagelneuer Fragen kommt da auf die Naturforscher zu, die nun wirklich nicht die Natur selbst aufgeworfen hat. Für deren Beantwortung ist ihr Sachverstand am lebhaftesten gefragt.
Da dürfen sie nun ihre neuesten Erkenntnisse z.B. über die chemische Reaktionsfähigkeit neuer und alter Stoffe im Dienst der Frage gewinnen, wie eine Mülldeponie am kostengünstigsten zum Grundwasser hin abgedichtet werden kann oder wie aus zwei Arzneimitteln ein gut verkäufliches drittes wird. Der Geschäftssinn und die verheerenden „Neben“-Wirkungen einer Produktionsweise, die mit Land und Leuten lauter geschäftstüchtige Großversuche „in vivo“ veranstaltet, geben den Experten der Nation viel anzupacken.
Zu Ehren kommt ihr dienstbarer Geist aber vor allem dann, wenn sie Fragen beantworten sollen, die den Bereich naturwissenschaftlicher Kompetenz überschreiten. Politiker, die auf alles aufpassen sind nämlich immer, wenn mal wieder was Dummes passiert ist eine Zeitlang an „Risikostudien“ interessiert: Sie wollen Prognosen, und zwar nicht bloß über das Wetter von morgen und das nächste Erdbeben unter Los Angeles, sondern vor allem zu der Zukunftsfrage, wie sehr zukünftige Wirkungen von heute eingeleiteten oder zur Ausnutzung vorgesehenen Naturprozessen gewisse allgemeine gesellschaftliche Zwecke behindern, beeinträchtigen oder gefährden werden.
Naturforscher lassen sich da nicht lumpen; ihre Expertisen haben aber einen Haken. Erstens sind naturwissenschaftliche Erkenntnisse nämlich überhaupt etwas anderes als Prognosen. Man braucht sie zwar, um die Bedingungen zu berechnen, unter denen beispielsweise eine Rakete ihre Umlaufbahn erreicht oder gewisse Ausgangsstoffe die gewünschte Synthese bilden. Gerade in der technischen Praxis zeigt sich aber, dass Naturgesetze nicht zusammenfallen mit der sicheren Vorhersage eines bestimmten Ergebnisses, an dessen Zustandekommen allemal die verschiedensten Ursachen gesetzmäßig, aber nicht voraussehbar mitwirken. Unter die notwendigen Wirkungen, die Naturwissenschaftler ausrechnen können, fällt zweitens erst recht nie die Antwort auf Fragen, die in der einen oder anderen Form ein „wie schlimm?“ zum Inhalt haben. „Gefährlich“ oder „unerheblich“ sind ein für allemal keine naturkundlichen Kategorien, sondern gehören zur Logik jener Beurteilung natürlicher Gegebenheiten und Effekte, die diese zu individuellen oder gesellschaftlichen menschlichen Bedürfnissen ins Verhältnis setzt. Das Wissen etwa über Dioxin, seine Synthese und seine Reaktionsfähigkeit erlaubt sicherlich Schlussfolgerungen darüber, was es wo und wie im menschlichen Körper bewirkt; aber es gibt keine Voraussage darüber her, wieviel von diesem Zeug bei verschiedenen Produktionsprozessen freigesetzt und von der Menschheit nicht aufgenommen wird; und erst recht lässt sich durch keine noch so eingehende Prognose auf wissenschaftlicher Basis festlegen, welche Effekte man für tolerierbar und welche für ein Risiko halten will. Wo der Naturforschung solche Urteile abverlangt werden, soll sie in den Dienst von Abschätzungen treten, die genauso wenig naturwissenschaftlichen Charakter haben wie eine Statistik der Krankheitskosten oder eine betriebswirtschaftliche Ertragsrechnung.
Genau dieser Dienst macht aus den Naturforschern erst Experten mit einer prominenten gesellschaftlichen Rolle. Als solche sind sie immer wichtiger geworden, seit der herrschende gesellschaftliche Gebrauch der Natur diese für immer mehr Zwecke außerhalb und sogar innerhalb des Bereichs geschäflicher Zwecksetzungen unbrauchbar macht und Gefahren schafft. Da gilt es z.B., MAK-Werte auszurechnen: für jedes bei lohnender Industrieproduktion anfallende Gift diejenige Menge in der Betriebsatmosphäre, bei der die staatliche Aufsichtsbehörde sich über die Volksgesundheit keine größeren Sorgen zu machen braucht, weil sie mit bestem Gewissen die „Prognose“ vertreten kann, dass „ein Guter es aushält“. Aus der Statistik der Krebsraten bei unterschiedlichen Arten und Graden ionisierender Bestrahlung der Menschheit sollen Experten ermitteln – und sie tun es ohne Wimperzucken –, bei welcher Dosis ihnen eine Korrelation nicht mehr signifikant vorkommt, so dass die allgemeine Einsicht: „Keine Dosis ist unschädlich.“ Sich mit einer akzeptablen Becquerel-Zahl pro Kubikmeter Atemluft, Quadratmeter Liegewiese und Kilo Haselnussnougat vertragen lernt. Ausgerechnet das Wissen über ein paar Gesetze des Naturgeschehens soll eine sichere Meinung darüber hergeben, wie viele „Minuten vor zwölf‘ es schon ist oder ob die Sache nicht doch noch auf absehbare Zeit „gutgehen“ kann.
Der Meinungsstreit der Experten kann gar nicht ausbleiben. Zahllose unentschiedene Debatten über die Gefährlichkeit der Atomkraft und des Autoverkehrs haben das demonstriert. Der „Wirrwarr“ um die Grenzwerte harmloser Radioaktivität nach dem Fallout von Tschernobyl hat endgültig das Volksurteil bestätigt, dass Experten sich geradezu auszeichnen durch die unterschiedlichen bis gegensätzlichen Auffassungen, die sie in ein und derselben „Sachfrage“ vertreten und „wissenschaftlich“ bestens begründen können. Expertentum gilt nicht als Beendigung, sondern als eigene Quelle einer unversöhnlichen Meinungsvielfalt. Dieser Zipfel einer Einsicht, die ja an sich gar nicht so falsch ist, hat allerdings überhaupt nicht dem Schein geschadet, da würde nur mit und um wissenschaftliche Argumente gestritten. Populär geworden ist ja bloß der sowieso populäre Unsinn, auch Naturforschung wäre ein in sich pluralistisches Geschäft. Und das ist das gerade Gegenteil der wirklich nicht schwierig zu erfassenden Wahrheit: Der ganze Experten-Pluralismus liegt ausschließlich in dem überhaupt nicht naturwissenschaftlichen Urteil darüber, wieviel an Zumutungen gegenüber dem betroffenen Volk die politische Obrigkeit sich herausnehmen sollte oder sich doch nicht leisten darf.
Aber warum hätte ausgerechnet das vollgelaberte Publikum auf diese Unterscheidung kommen sollen? Die zu publizistischen Ehren gekommenen Experten selbst haben ja alles daran gesetzt und tun alles, um ihr Wissen über Ursache und Wirkung mit ihrer politischen Einschätzung der mutmaßlichen Wirkungen zu vermanschen. Sie haben sich als Experten in der eigentümlichen Sorte korrupten Denkens bewährt, das die erkannten Naturgesetze als Berufungsinstanz für die Verlautbarung risikobewusster Ratschläge missbraucht. Sie beziehen ihr ganzes Renommee aus der Verfälschung der gesellschaftlich fest verankerten Exklusivität naturkundlichen Wissens – also der Unbildung kapitalistisch zivilisierter Völker – in Autorität. Inzwischen haben man/frau mitbekommen, dass jeder politische Standpunkt ganz locker seine naturwissenschaftliche Expertenmeinung vorweisen kann; und gleichzeitig ist jedermann klar, dass das kein Grund zur Kritik an den Fehlern und Absichten des politisierenden Expertentums ist, geschweige denn an den Standpunkten, die sich mit käuflichem Fachidiotentum schmücken, sondern ein Grund zur Skepsis – gegen die Naturwissenschaft: die ginge halt so!
Wie sauber nimmt sich demgegenüber die heile Welt der „reinen Forschung“ aus, wo der freie Forschergeist ohne politischen Auftrag und geschäftlichen Zweck den Quarks und den Gravitationswellen im erdfernen Raum und den letzten Geheimnissen des Lebens nachspürt!
Oder doch nicht ganz ohne materiellen Zweck und Auftrag? Als Geldgeber muss allemal ein dickes, staatlich unterstütztes Kapital oder gleich der Staat ran, wo es um die „reine Forschung“ geht; denn was sich am Labortisch Marke Otto Hahn erkennen lässt, ist irgendwie ausgeforscht. Für den kostspieligen Aufbruch des forschenden Geistes in die letzten „unbekannten Welten“ hat der moderne bürgerliche Staat aber seine Eigene guten Gründe. Die gern bemühte Analogie zum klassischen Entdeckertum ist keine bloße Metapher. Staatliche Souveränität schließt den Willen ein, schlechterdings alles im Griff und unter Kontrolle zu haben, was sich als Mittel oder Bedingung ihrer Macht erweisen könnte. Dieser Wille duldet keine weißen Flecken auf der Landkarte und auch kein unerforschtes Gelände in den kleinsten wie in den weitesten Bereichen des Raumes. Er ist so prinzipiell, dass entdeckungsfreudige Individuen seine imperialistische Qualität leicht und leichten Herzens übersehen können und nichts als eine Chance für ihren Idealismus darin wahrnehmen – auch wenn Atombombe und SDI einiges über den Fortschritt klarstellen, den die Staatsgewalt aus den Errungenschaften ihrer Forscher zu verfertigen versteht und pflegt.
Der Staat organisiert seinen Willen zu schrankenloser Zuständigkeit und Kontrolle an den vordersten Fronten als eine „zweckfreie“ Sphäre des „reinen“ Forschens. In dieser „Welt für sich“ fühlen sich Naturforscher, die nicht so vorrangig den Expertenehrgeiz in sich spüren und auch nicht unbedingt mit der Erfindung phosphatfreier Waschmittel reüssieren wollen, sauwohl. Sie bedanken sich für ihre zweckmäßige Freiheit, indem sie ihr Betätigungsfeld mit Eigene persönlichen Zwecksetzungen befrachten – naturgemäß solchen der wunderlichen Sorte.
Da gibt es das Phänomen erwachsener Menschen, die sich allen Ernstes mit dem Gegenstand ihrer wissenschaftlichen Neugier identifizieren. Das spricht zwar weder gegen die Korrektheit ihres Forschens noch gegen die Richtigkeit ihrer Ergebnisse, zu denen sie es bringen. Eine vernünftige Beurteilung der Welt ist es aber auch nicht gerade, sie in zu- und abträgliche Bedingungen für die Auskundschaftung der schwachen Wechselwirkung im Atomkern oder für das Recht anderer Naturobjekte auf Erforschung zu unterteilen.
In ihrer Fürsorge für ihr Forschungsobjekt bringen Naturwissenschaftler es auch zu erbitterten Konkurrenzen völlig ungeschäftlicher Art: Einen Stern oder ein Virus als erster entdeckt zu haben und das Menschenrecht auf seine Benennung zu besitzen, ist ein Ehrenpunkt, auf dessen Verteidigung und Menge mancher leicht doppelt so viel Mühe und Engagement verschwendet wie auf Forschungstätigkeit im engeren Sinne. Manches ehrgeizige Forscherleben soll auch schon mit einem gelungenen Selbstversuch seinen krönenden Abschluss gefunden haben. Völlig überflüssigerweise wird die Konkurrenz idealistischer Fachidioten überdies durch den jährlichen Preis angestachelt, den der große Sprengstofferfinder auch und vor allem für die Weltmeister im Naturforschern ausgesetzt hat. Wenn dann das Institut seinen Nobelpreisträger als anerkanntes Symbol der nationalen Leistungskraft feiert, darf die Öffentlichkeit miterleben, wieviel kindisches Gemüt dabei herauskommt, wenn das Leben ein einziger Dienst am Fortschritt selbstzweckhafter Gelehrsamkeit ist.
Da Naturforscher den Gegenstand, dem sie ihr Leben weihen, für an und für sich höchst wichtig halten, fühlen sie sich auch immer wieder gedrängt, das breite Publikum in seine Erforschung einzuweihen. Logischerweise kommt dabei regelmäßig etwas ganz anderes heraus als die der Sache einzig angemessene trockene Erklärung. Das ist ihnen zu wenig; sie wollen nichts Geringeres als die „Faszination“ rüberbringen, die sie ihrem Objekt mindestens abgefühlt haben wollen. Das trifft sich gut mit den Bedürfnissen eines Publikums, das von der Naturwissenschaft genug Ahnung hat, um sonst nichts, aber auf alle Fälle das Eine zu wissen: dass der gebildete Mensch davon eine Ahnung haben muss. Dieser Wissensdurst ist auf eine Unterrichtung aus, die nicht die Gesetze des Naturgeschehens, sondern deren Wichtigkeit für alles Mögliche und vor allem für das Funktionieren der großen weiten Welt zur wesentlichen Botschaft macht und damit mehr die Vorstellungskraft unterhält als den Verstand belehrt. Naturforscher, die durchaus Kenner ihrer Materie sein mögen, geben sich allemal dafür her, dieses Bedürfnis anzuleiten und ausgerechnet ihr Wissen zum Mittel des Staunens zu machen – statt umgekehrt der Verwunderung die frühere Philosophen für den zu überwindenden Ausgangspunkt des Nachdenkens gehalten haben) und der daraus genährten Schicksals- und Schöpfungsgläubigkeit ihr wohlverdientes Ende zu bereiten. Das fängt in der Volkssternwarte an, die mit der Größe der fürs Weltall zuständigen Entfernungsmaße und Massen Eindruck machen will. Das kommt so richtig zum Zug im Fernsehen, wo gestandene Naturkundler demonstrieren dürfen, dass sie ihren Gegenstand und dessen in blöde Bilder verpackte Bewunderung – „Auf sooo einem kleinen Chromosom so viele Informationen wie im Telefonbuch von Chicago!“… – selber schon gar nicht mehr auseinanderhalten können.
Naturwissenschaftler mit Distanz zur Forschung und gehobenen weltanschaulichen Ansprüchen beschäftigen sich gerne damit, diesen Standpunkt der begriffslosen Ver- und Bewunderung zu einer Weltsicht auszuarbeiten. Da pflegt dann „der Mensch“ als Stäubchen im All, aber andererseits auch maß-setzende Mitte des Kosmos und verantwortungsbeladener Hüter der Schöpfung und ihrer Wunder zu Ehren zu kommen – zu scheinbar wissenschaftlicher Ehre; denn das ist das Perfide daran, wenn die hauptberuflichen Kenner der Naturgesetze skrupellos den Königsweg von der Atom- oder Weltall-Physik zur Metaphysik beschreiten: Die Predigt soll da wie ein Naturgesetz gelten. Fürs gehobene Unterhaltungsbedürfnis wird die Straße von der Science zurück zur Fiction mit den „Geheimnissen der 4. Dimension“, den „Rätseln der Schwarzen Löcher“, dem „Urknall“ und ähnlichem gelehrten Unfug gepflastert.
Das Opfer an wissenschaftlichem Verstand, das Naturforscher bringen, tut ihnen nicht weh. Sie gewinnen dafür ja an weltanschaulicher Autorität. So ziehen sie im demokratischen Wertekanon mit ihren Kollegen gleich, die als Experten ihr Wissen für die Pseudorechtfertigung politischer Standpunkte abliefern. Selbst mit anerkannten Spinnern von der geisteswissenschaftlichen Front dürfen sich die Naturkundler messen. Und darauf scheint es schwer anzukommen, wenn in der bürgerlichen Gesellschaft aus Wissen ein ehrbarer Beruf wird.
Beruf: Offizier
Unter den akademischen Berufen nimmt der Offiziersstand eine Sonderstellung ein. Daran hat auch die originelle Erfindung eines „Bürgers in Uniform“, wie sie sich die Nachfolgetruppe der alten Wehrmacht geleistet hat, nichts ändern können. Man hat bei diesem Job der akademischen Elite nämlich nicht die geringste Schwierigkeit, die geistigen Fähigkeiten klar zu umreißen, die für die Tätigkeit des Offiziers vonnöten sind. Es geht darum, den Befehlen von oben zu gehorchen und vor allem nach unten Befehle zu geben. Deren Inhalt sind lauter recht einfache Dinge, die außerdem die Befehlsempfänger schon allein draufhaben müssen.
Das soll nicht heißen, dass der Offizier blöder wäre als z. B. der Psychologe oder der Pfarrer oder der Politiker oder der Manager. Immerhin ist als Laufbahnvoraussetzung auch für ihn das Abitur verlangt, sogar eine Bundeswehrhochschule muss er absolvieren. Dann soll er aber gar keine Predigten verfassen oder betrübte Zeitgenossen gesprächstherapieren oder erfolgreiche Verkaufsgespräche führen oder Wähler betören. Sein Beruf ist es, Disziplin zu halten in der Truppe. Und dazu befähigt den Offizier in erster und letzter Instanz nur eins: auf der Uniform Sterne, Eichenlaub und Sterne, in Silber oder Gold. In der Uniformität der soldatischen Truppe beweist der durch Rangabzeichen äußerlich kenntlich gemachte Unterschied zwischen den Soldaten den inneren Gehalt der Funktion der Hauptleute, Stabsoffiziere und Generale: Der Offizier hat für die hierarchische Gliederung des Soldatenhandwerks einzustehen, und dafür steht er auch ein.
In der modernen Gesellschaft haben aber auch Offiziere ein Recht darauf, dass ihre Befehlsgewalt zu einer geistigen und moralischen Berufung der besseren Art zurecht interpretiert wird. Also definiert die moderne Bundeswehr – zugegeben reichlich allgemein und beschönigend – den Offizier als „vor allem Führer von Menschen“. Mit dieser Umschreibung seiner Berufstätigkeit wird einerseits durchaus benannt, dass da ein Vorgesetzter über Untergebene gebietet. Andererseits wird aber so getan, als handle es sich schon allein deswegen um eine besonders hohe und schwierige Aufgabe, weil Offiziere es überhaupt mit Menschen zu tun haben, die bekanntlich mit Willen und Verstand begabt sind. Statt an den Inhalt der „Menschenführung“ soll man gleich an Pädagogen und Psychologen denken, die ja auch mit dem hohen Gut „Menschenkind“ hantieren. Tatsächlich wird den Offizieren eingebimst – und sie bilden sich so etwas dann auch ein –, es wäre notwendig für ihren Beruf, ein wenig „Feldherr Psychologos“, ein bisschen Pädagoge zu sein. Es wird aber nicht verschwiegen, dass die erfolgreiche Menschenführung des Offiziers nur „zum Teil erlernbar“ ist. Machen wir uns also nichts vor und sagen es militärisch kurz und knapp:
Den Offiziersberuf erlernt man durch die Gewohnheit, untergebene Soldaten auf allen Ebenen des militärischen Handwerks zu kommandieren. Verlangt ist die Entwicklung der geistigen Fähigkeit, bewusst und absichtlich keine Rücksicht zu nehmen auf das Interesse, die Überlegungen, den Willen des Menschen Soldat, sondern bedingungslosen Gehorsam zu verlangen. Der befehlende Offizier muss jederzeit zu der Kaltschnäuzigkeit bereit sein, den Willen der Soldaten – „bis zur Überwindung des natürlichen Selbsterhaltungstriebs“ – zu brechen. Schließlich steuert er ja nicht irgendwelche Prozesse; und der für alle anderen Elitejobs so charakteristische Schein, der ausgeübte Zwang wäre der einer unwidersprechlich vernünftigen Sache“ und die verlangte Unterordnung der geradeste Weg zum Eigenen Vorteil, kann bei der Herstellung militärischer Disziplin bei aller Schönfärberei letztlich doch bloß stören. Zwar bringt ein guter Offizier es locker fertig, noch seine erlesensten Schikanen als Hilfestellung auszugeben, die der schikanierte Befehlsempfänger ,im Ernstfall“ erst richtig zu schätzen wissen wird. Diese pädagogische Nettigkeit hat aber den Haken, dass sie eben einen Ernstfall vorwegnimmt und einübt, der jeden normalen Opportunismus, also jede übliche Bereitschaft, sich „Sachzwänge“ und Disziplinierung gefallen zu lassen, zunichte macht.
Der Offizier muss sicherstellen, dass er und seine Jungs funktionieren, wenn es ausschließlich darum geht, zu zerstören und zu töten, und zwar unter Einsatz des Lebens. Und einen Vernichtungstrieb, an den er dabei konstruktiv anknüpfen könnte, lernt der Offizier bei seinen normalen Wehrpflichtigen nie kennen – entgegen allen einschlägigen Gerüchten aus der Werkstatt der Psychologie.
Die Autorität des Offiziers entbehrt so gar jeden Scheins von Begründung. Sie wird nicht erworben, sie hängt nicht von geistigen Qualitäten oder sonstigen menschlichen Eigenschaften ab. Der Offizier hat sie, wenn ihm mit der Ernennung die Befehlsgewalt übertragen wird. Alles andere, dass er Vorbild sein soll, gerecht gegenüber den Untergebenen, ihre Sorgen kennen muss usw., gehört in die Abteilung Lametta, das das tatsächliche Gewaltverhältnis behängt; mit dem bewussten Zweck, dass der einfache Soldat dann sagen kann: „Als Vorgesetzter hart, aber doch ein Kamerad, ein Mensch, durch dick und …“. Noch an der militärischen Ehrenbezeugung wird sinnfällig, dass die Autorität des Offiziers nur auf seiner Befehlsgewalt gründet: Gefreiter X mag den Hauptmann Y nicht mehr sehen können, seine Witze für bodenlose Sockenauszieher halten, ihn noch gestern stinkbesoffen bei seinem Geisteszustand ertappt haben, er hat die Hand zum Gruß zu erheben, wenn der vorbeikommt.
Wissen muss ein Offizier natürlich, wie ein Befehl geht, also die Dienstvorschriften kennen. Dass ein Befehl „knapp“ (Stillgestanden!), „klar“ (Augen rechts!) und „verständlich“ (Die Augen links!) zu sein hat, weiß er genau. Dass seine Anweisungen „natürlich, taktvoll, aber bestimmt“ (Wegtreten!) lauten sollen, lernt er auch. Ebenso die Gewaltmittel, die ihm zur Verfügung sehen, um die Probleme zu bewältigen, die bei seiner „Menschenführung“ auftreten: erzieherische Maßnahmen, die Disziplinargewalt, das Wehrstrafrecht. Sicher kennt er sich auch aus in der Ideologie, die zum Führungsauftrag dazugehört: „Befehle, wenn irgend möglich, sachlich zu begründen; die Untergebenen zu „motivieren“; ihr vertrauen zu gewinnen“. Weil der Mechanismus von Befehl und Gehorsam davon nicht abhängt, kommt hier die Persönlichkeit des Offiziers zu ihrem Recht: das Reich der Freiheit, am Eigene Image in der Kaserne zu basteln, so oder so.
Fehler kann der Offizier machen, wenn er seine Befehlsgewalt zu übertrieben heraushängen lässt, also z. B., statt auf dem Weg zum Dienst „Im Laufschritt, Marsch!“ anzuordnen, den „Entengang“ befiehlt, was gemäß Dienstvorschrift der Bundeswehr „die persönliche Ehre“ des Soldaten verletzt. Woran man sieht, wie fein der Unterschied zwischen der sachlich begründeten Ausübung der Befehlsgewalt ist. Sogar Befehle, die gegen das „Kriegsvölkerrecht“ verstoßen, darf der Offizier nicht geben.
Ein Feindbild und einen Standesdünkel benötigt ein moderner Offizier nicht. Er weiß, dass Feindbilder nur beim Feind gepflegt werden. Und sein eigenes Elitebewusstsein hält er für sachlich völlig gerechtfertigt; z. B. durch das moderne Gerät, das er bedienen darf, und nicht zuletzt durch die Hochschulen, die extra für ihn gebaut sind. Er sieht in sich den Diener der Freiheit aller und geht in seiner Selbstverleugnung so weit, mit Panzerarmeen und Raketen sogar die Freiheit der Friedensbewegung zum Demonstrieren zu schützen, obwohl die ihm das gar nicht dankt, also auch eigentlich nicht verdient.
Wer als Offizier in die höheren Ränge befördert wird, darf immer größere Einheiten im Gefecht befehligen, was er dann auch meistens kann. Als Stabsoffizier oder General wird er schließlich fähig, auf den höchsten Ebenen von Strategie und Taktik planerisch mitzuwirken. Solchen mehrsternigen Generälen ist es dann sogar erlaubt, politisch Stellung zu nehmen – wenn der Inhalt auf Regierungslinie liegt. Denn loyal gegenüber der politischen Führung müssen alle Offiziere sein. Offiziere haben als Befehlshaber der nationalen Armee für deren kriegsfähige Schlagkraft zu sorgen; insofern sind sie unerlässlich für das nationale Interesse und verleihen den außenpolitischen Vorhaben der Staatsmacht erst ihr nötiges Gewicht und ihre Überzeugungskraft. Dass sie so nur Werkzeug der Souveräne des Staates sind – und nicht dessen wahre und eigentliche Herren wie z. B. die südamerikanischen Kollegen –, regt in einer wehrhaften Demokratie keinen Offizier auf; eher schon die Tatsache, dass man bisher die Schlagkraft der Truppe noch in keinem wirklichen Gefecht hat erproben können.
Aber das sollte keinen Aspiranten von der Offizierslaufbahn abschrecken. Dieser Beruf ist unter allen akademischen Berufen der krisensicherste, solange eine Staatsgewalt mit ihren internationalen Interessen regiert. Und da ist ja kein Ende abzusehen. Und noch etwas kann den Offizier froh stimmen. Die Zeiten, da man nach der unseligen Niederlage in Weltkrieg II die Offiziere ein wenig in den Kasernen versteckte oder nur als in Uniform verkleidete Studienräte vorzeigte, sind vorbei. Sie dürfen sich wieder sehen lassen, die deutschen Offiziere, nicht nur auf dem Manöverball vor jungen Damen. Außerdem ist die Hoffnung, dass sie endlich einmal ein echtes Gefecht befehligen, wahrlich nicht unbegründet. „Prost, Prost, Kameraden …“
Beruf: Pfarrer
Pfarrer sind Leute, die Gottes Ruf vernommen haben. Egal, wann und unter welchen Umständen sie diesen Anruf verspürt haben wollen: Es genügt, dass sie sich ihre Mission heftig genug einbilden, um im Dienste Gottes der Akademiker-Arbeitslosigkeit zu entgehen.
Messe lesen, Beichte hören, Sakramente verteilen – so schwer ist das nicht. Dazu muss man sich nur die richtigen Klamotten anziehen, die passenden Texte – wahlweise auf lateinisch oder deutsch – sowie das entsprechend würdevolle Gehabe auf Lager haben, dann geht alles seinen Gang. Witwen und Waisen trösten, Kranke besuchen, Tote beweihräuchern, mit Nonnen schäkern – ist auch nicht sonderlich kompliziert. Die gläubige Menschheit ist genügsam. Dass der Herr Pfarrer tatsächlich persönlich vorbeischaut, reicht für den beabsichtigten Eindruck. Und das Schönste ist sowieso, wenn er dann wieder geht.
Schwierig ist der Beruf eigentlich nur in einer Hinsicht: Für den höchsten Chef muss Werbung veranstaltet werden. Bei der pastoralen Agitation tut man sich mit Kindern und Omas relativ leicht. Sie sind ein dankbares Publikum für die alten Stories vom lieben Gott mit seiner grenzenlosen Güte und strafenden Gerechtigkeit, von den Menschen, die ewig Scheiße bauen, und vom Gottessohn mit seiner Krippe und seinem Kreuz. Darüber hinaus kann man auf den Teufel, die Schutzengel, ganze Heerscharen von Heiligen und jede Menge Jungfrauen zurückgreifen, um den alten und jungen Schafen der Gemeinde die Botschaft kindgemäß aufzubereiten, auf die der ganze Zirkus sowieso so sicher wie das Amen in der Kirche hinausläuft: Gottgefällige Erdenwürmer sind brav, gehorsam, demütig und haben ein frohes Herz, was immer auch in diesem „Jammertal“ mit ihnen angestellt wird.
Damit ist die Abteilung ‚Kinder und Senile‘ bestens bedient und der Großteil der wöchentlichen Predigtvorbereitung erledigt. Andere regelmäßige Gottesdienstbesucher sind nämlich sowieso nicht zu erwarten. Aber was ein echter Pfarrer ist, der legt sich noch lange nicht auf die faule Haut und lässt Gott einen guten Mann sein. Im Gegenteil, er nutzt seine Freiheit, um die göttliche Mission zu erfüllen und sich auch an die ältere Jugend und die Erwachsenenwelt mit der frohen Botschaft anzuwanzen.
Ein Pfarrer von heute ist natürlich nicht von gestern und weiß, dass es sich hierbei um eine etwas sperrige Klientel handelt. Leuten, die mit allen Wassern der kapitalistischen Konkurrenz gewaschen sind, will er aufreden, dass sie die christlichen Tugenden der Demut, Bescheidenheit und Nächstenliebe zu beherzigen haben – und zwar ganz ohne Berechnung aufs Diesseits. Christliche Seelsorger verstehen etwas von PR; sie wissen, dass sie das Bedürfnis nach ihrem ewig gleichen, penetranten Angebot „Auch Du brauchst Jesus“ bei der Kundschaft erst wecken müssen.
Die klassische Einstiegsdroge auch für Erwachsene ist ein Sündenbewusstsein. Dazu kann man auf altbewährte „Argumentationsmuster“ zurückgreifen. Die Menschheit ist per definitionem sündig (Erbsünde und so): Mensch ist Mensch, und Gott ist Gott. Deshalb muss man gnadenlos auf die Gnade Gottes vertrauen. Das sind noch allemal interessante Überlegungen für moderne Menschen, die sich ihr „Lebensschicksal“ nicht erklären, sondern zufriedenstellend rechtfertigen wollen. Die Sache hat nur einen kleinen Haken. Die „aufgeklärte Menschheit“ des 20. Jahrhunderts treibt sich nicht mehr gewohnheitsmäßig im Schoß der Kirche herum, sondern hat die Auswahl zwischen verschiedenen Angeboten zur moralischen Erbauung. Kirchenbesuch und die Sündentour treffen längst nicht mehr jedermanns Geschmack.
Aber Pfarrer sind studierte Leute. Sie haben ihr Philosophikum nicht umsonst gemacht und verstehen sich bestens darauf, dieselbe Botschaft methodisch modern zu verpacken. Ihre wichtigste Werbemasche heißt: Sinnbedürfnis befriedigen. Die bescheuerte Frage nach dem Sinn des Lebens, nach einem schicksalhaften guten Grund aller Dinge jenseits der sehr realen, irdischen Zwecke, die Menschen verfolgen oder denen sie unterworfen werden, hat sich in den Köpfen der abendländischen Menschheit aus sehr schlechten irdischen Gründen festgesetzt. Pfaffen nehmen sich die Frechheit heraus, jedermann mit der Frage zu behelligen: „Wofür lebst Du überhaupt?“ Und damit wollen sie keinesfalls an die Zwecke erinnern, die die Leute üblicherweise so im Kopf haben: „Für meine Familie, für meine Arbeit, für meinen Gewinn, für meine Aktien, für meinen Urlaub, für den Genuss, fürs Arbeitsplätze schaffen, für Deutschland“. Pfarrer haben es darauf abgesehen, dass sich der Rest der Menschheit mit seinen Zwecken vor ihnen rechtfertigt; und dabei ist längst klar, dass sie keine einzige Rechtfertigung gelten lassen. Außer eben den höchsten Zweck, an dem sie das Dasein der Leute und ihren Lebenssinn blamieren wollen. Dienstbarkeit für diesen fiktiven, geheimnisvollen Oberzweck – namens Gott – ist ihr Maßstab.
Die Katechismus-Antwort auf die Frage: „Wozu sind wir auf Erden?“ – „Um Gott zu loben und zu preisen und dadurch in den Himmel zu kommen.“ – mögen moderne Pfarrer nicht mehr so ohne weiteres feilhalten. Dafür werben sie aber nur um so nachhaltiger für das Prinzip dieses metaphysischen Frage-und-Antwort-Spiels: für die Fiktion einer von keinem Menschen und keiner wirklichen Instanz gesetzten Zweckbestimmung, der die Leute in ihrem Tun und Lassen gehorchen müssten und von der man ansonsten nur eines sagen kann, nämlich dass keine wirkliche, geschweige denn eine vernünftige Absicht an sie heranreicht. Sie machen Propaganda für eine grundlose Selbstkritik, die alles, was es gibt, mit dem interessanten Argument „bloß irdisch“ in den Staub zieht. Sie agitieren für die Einbildung einer göttlichen Weisheit in allem Geschehen, an der der menschliche Verstand sich nur blamieren kann; also für eine selbstverantwortete Unmündigkeit. Als Lohn für so viel Knechtsgesinnung winken die Pfaffen mit einem Preis: Wenn man schon sonst nichts davon hat, kann man sich zumindest bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit als Parteigänger des allerhöchsten Vorschrifts- und Lenkungswesens aufführen, um ihr Angebot an Mann und Frau zu bringen, haben die Pfarrer sich auf den berechnenden Umgang mit dem enttäuschten Materialismus der Leute spezialisiert. Anlässe, an denen der Großteil der Menschen feststellen kann, dass die Eigene bescheidenen Vorhaben und Ziele, auf die man es im Leben abgesehen hat, nichts zählen, bietet eine florierende Marktwirtschaft in Hülle und Fülle. Enttäuschung über die kümmerlichen Ergebnisse der Eigene Anstrengungen im Berufsleben und Unzufriedenheit mit dem meist fragwürdigen Glücksgewinn, den die Familie bereitet, sind an der Tagesordnung. Für den Seelsorger eine hervorragende Gelegenheit einzuhaken.
Den „Erniedrigten und Beleidigten“ stehen Pfarrer großherzig mit Rat und Trost zur Seite. Das „Jammertal-Argument“ wird in Anschlag gebracht: Das Diesseits ist nun mal beschissen – das hat der liebe Gott so eingerichtet, damit’s für die Braven im Jenseits um so lustiger wird. Warum das so sein muss, weiß kein Mensch – aber das ist ja gerade der Witz am lieben Gott.
Auch der enttäuschte Glaube an einen moralischen Weltlauf wird bedient. Leuten, die ihr Lebtag brav und treu jede Pflicht erfüllen und enttäuscht feststellen, dass sie damit auf keinen grünen Zweig kommen, kann geholfen werden. Das Jenseits sorgt für den Ausgleich, den das Diesseits nicht bringt: So zahlt Tugend sich letztlich doch noch aus, und die bürgerlichen Grundwerte, Gerechtigkeitswahn und Neid, sind christlich bestätigt. Und wenn er schon vom Jenseits faselt, wird es sich kein echter Pfaffe entgehen lassen, seinen mit der Welt und dem Nächsten unzufriedenen Schäflein selber mit allem Nachdruck auf den Zahn zu fühlen. Dann kommen die Anekdoten vom „Balken im Eigene Auge“ und den „Steinen, die man nicht immer werfen soll“, zum Einsatz. Es gilt nämlich, das schlechte Gewissen, das zur Tugendhaftigkeit immer dazugehört, zu fördern und auszubauen. Die Vorstellung von einer höheren richtenden Instanz ist der ergiebigste Ansatzpunkt beim Publikum, um seine betrübten Selbstzweifel und seinen verkehrten Weltschmerz in die richtigen, göttlichen Bahnen zu lenken.
Es gibt allerdings jede Menge Leute, denen die pastoralen Angebote zu antiquiert erscheinen. Bei denen lohnt sich auf jeden Fall der Versuch, ihnen den lieben Gott mit dem labbrigsten aller Sinn-Erfolgsschlager schmackhaft zu machen: „Irgendeinen Sinn muss alles doch haben.“ Klar, ohne Sinn ist alles sinnlos. Und für diesen Sinnspruch hat die christliche Kirche immerhin ein verbindliches Argument auf ihrer Seite: Sie ist die staatlich anerkannte Instanz für „letzte Fragen“. Es wird christlich erzogen, geheiratet und gestorben; von der Wiege bis zur Bahre gibt es für jede Gelegenheit ein Angebot kirchlichen Lebens; die Gemeinschaft der Gläubigen ist eine rechtlich geschützte öffentliche Macht, die sich nicht nur auf ihren Kirchentagen zur Show stellt, sondern tagtäglich mit ihren Repräsentanten moralische Fragen aufwirft.
Mit dieser Autorität im Rücken bemüht sich der Pfarrer, der christlichen Botschaft dadurch eine letzte Autorität zu verleihen, dass er sie so glaubhaft wie möglich als die Seine, als seine höchstpersönliche innerste Überzeugung darstellt. Dafür fordert das Pfarramt den ganzen Menschen. Ein Herr Pfarrer braucht nichts so sehr wie eine persönliche Ausstrahlung, mit der er als leibhaftiger „Beweis“ für die Richtigkeit der christlichen Lehre durch die Gegend strahlen kann. Ein paar Marotten zur Persönlichkeitsgestaltung gehören dazu; je nachdem, welches „Feld des Herrn“ gerade zu beackern ist.
Die Auswahl an pfäffischen Charaktermasken ist nicht allzu groß und ihre Übergänge sind fließend. Im Laufe seiner Dienstjahre lernt ein Pfarrer sie alle darzustellen.
Der Weltoffene, politisch Verantwortungsvolle empfiehlt sich vor allem für Studentengemeinden und ähnliches. Zur Grundausstattung gehören Gitarre und Jeans. Lila Halstücher für den Frieden und gelegentliches Einreihen in eine garantiert gewaltfreie, nächstenliebende, absolut gute Menschenkette machen sich auch nicht schlecht, wenn der Zeitgeist es gerade so will. Zu allen sich bietenden Gelegenheiten wird ein 3.-Welt-Basar organisiert und mit der reiferen Jugend über die Theologie der Befreiung diskutiert. Dabei kann man dann dezent mit der Eigene Distanz zur „verstaubten Amtskirche“ kokettieren und die beeindruckte Jungmannschaft für die einzig wichtige Botschaft weichklopfen: Verantwortliches politisches Engagement für das Elend der Welt ist nur dann richtig zu leisten, wenn man die Sache im Lichte der frohen, biblischen Botschaft betreibt und im Namen, also zum Nutzen der Kirche – „Mein Reich ist nicht von dieser Welt …“
Als lockerer Seelenhirte organisiert man auch schon mal Messen, bei denen es jugendbewegt zugeht. Oder man zelebriert das Abendmahl wahrhaftig wie seinerzeit der Herr Jesus am Esstisch. So wird Ergriffenheit und ein – im wahrsten Sinne des Wortes – irres Gemeinschaftsgefühl im Herrn inszeniert. Und wo das Mysterium des Glaubens so mit Händen zu greifen ist, da kann man denselben Zirkus auch wieder mit einer so richtig feierlichen Liturgie feiern: Rein in die Soutane mit den 33 Knöpfen, die farbenprächtigen Gewänder umgehängt, die goldige Monstranz hochgehalten und mit Weihrauchfässern gewedelt. Der Organist haut in die Tasten und spielt die alten Lieblingshits der Gemeinde. Da bleibt kein Auge trocken.
Selbstverständlich sind die Männer Gottes jederzeit bereit, den ganz persönlichen intimen Ratgeber abzugeben. Diese Tour ist eigentlich immer und überall einsetzbar. Moderne Menschen sind daran gewöhnt, alles und jedes auf der Welt in ein Problem zu übersetzen, das sie mit sich, ihrem Selbstbewusstsein und dem Sinn ihres Lebens hätten. Sobald man ihn nur lässt, kann sich der Herr Pfarrer da als Seelsorger in seinem Element fühlen. Er ist der Mann, der das Leben mit all seinen Abgründen kennt. Und dabei ist er doch ein guter Kamerad, dem man jeden Weltschmerz und Fehltritt erzählen kann. Der Trick verfehlt seine Wirkung selten, immerhin macht hier kein Geringerer als der Herr Pfarrer auf Kumpel, väterlichen Freund oder warmherzigen Bruder. Das Gesprächsmuster steht von vornherein fest. Die vertraulich ermunternde Eingangsfrage: „Hast Du ein Problem, mein Sohn, meine Tochter?“ führt zielstrebig zur „Lösung“: Jedes Problem ist in letzter Instanz eines mit dem Herrgott und löst sich im frommen Gang in die Kirche und zu den Sakramenten.
Man kann auch einen auf Hochwürden machen. Die eigene Strenggläubigkeit und Konzentration auf das Wesentliche lässt sich leicht dadurch sinnfällig machen, dass man prinzipiell nur in schwarzer Tracht durch die Gegend läuft. Dazu wird ständig gegen die Verwässerung und Verweltlichung von Glaubensfragen gewettert. Wenn man das alles noch mit dem gewissen MärtyrerFlair garniert, dass man ausgerechnet mit der göttlichen Sinnhuberei in der Wende-Republik 1987 schon auf verlorenem Posten für „den Weg, die Wahrheit und das Leben“ kämpft, kann es gar nicht ausbleiben, dass man am Ende von sich selber echt ergriffen ist.
Die Katholen haben als Oberknüller in puncto Glaubwürdigkeit den Zölibat anzubieten. Der tiefe Glaube des Herrn Pfarrer soll der unwiderlegbare Beweis für die Richtigkeit seiner Botschaft sein. Also muss der Glaube in Szene gesetzt werden. Der Verzicht auf Ehe und Familie wird als großes, aber frohen Herzens gebrachtes Opfer vorstellig gemacht. Und jeder soll sich dabei insgeheim denken, wer nicht vögelt, bloß um dem lieben Gott eine Freude zu machen – der muss von dem alten Herrn wirklich sehr angetan sein. Diese Sorte „Gottesbeweis“ funktioniert natürlich nur, wenn der Herr Pfarrer ein Typ ist, dem man abnimmt, dass er tatsächlich auf etwas verzichtet. Ein bisschen demonstrative Männlichkeit mit (mehr oder weniger) leisen Andeutungen, dass man selbstverständlich jede Menge Frauen hätte haben können, wenn man nur gewollt hätte – auch das gehört zum Berufsbild. Was dem katholischen Priester sein Zölibat, das ist dem evangelischen Pastor seine Familie. Pastoren beherrschen es genauso wie demokratische Politiker, ihr Privatleben samt lebendem Inventar zum Aushängeschild ihrer hervorragenden Persönlichkeit zu machen. Die vorbildliche Pfarrerfamilie weiß ein Lied davon zu singen, dass das Familienoberhaupt – obwohl ein ganz normaler Gatte und Vater – immer wieder den Stellvertreter Gottes auf Erden raushängen lassen muss. Das lässt sich nur mit der christlichen Dialektik von Sünde und Vergebung verkraften.
Mit diesem Repertoire an Überzeugungskünsten für den Allerhöchsten fristen die Gottesmänner der verschiedenen Konfessionen ihr ehrenwertes, sinnerfülltes Berufsleben bis zum seligen Ende. Auch wenn sie sich allesamt heftig einbilden, dass ihre Leistung nicht mit schnödem Mammon aufzuwiegen ist – die Gehaltsüberweisungen laufen regelmäßig ein. Deutsche Pfarrer können ihrem Herrgott dankbar sein, dass ihr Lebensunterhalt nicht vom zählbaren Erfolg ihrer Agitationsleistungen abhängt. Dank der Fürsorge des bundesdeutschen Staats genießen sie die Bequemlichkeiten eines Quasi-Beamten. Offenbar weiß ein Staat wie die BRD, was er an diesen Burschen hat: eine dauernde Agitationsinstanz für einen durch und durch staatsnützlichen Irrationalismus; eine Betreuungsinstanz für die Opfer des kapitalistischen Alltags, für Kranke, Alte, Obdachlose; eine garantiert staatsdienliche Organisation internationaler Pflege von Hunger und Elend – und eine moralische Institution, die auch sonst jeder Waffe ihren göttlichen Segen erteilt. Die Bundesregierung zieht ihren Bürgern, die so blöd sind, nicht aus der Kirche auszutreten, gerne die Kirchensteuer aus der Tasche für eine Gottes-Mannschaft, die gegen den allgemein üblichen bürgerlich berechnenden Umgang mit der Moral laufend für wirklich echte, von Herzen kommende Moralität wirbt, die noch die intimste Privatsphäre zu durchdringen hat.
Sie ist sogar so großzügig – in ihren Berechnungen –, dass sie den Kirchen aus ihrem eigenen Steuersack bzw. Dem der Bundesländer ganze theologische Fakultäten an den meisten staatlichen Universitäten spendiert. Dort studiert der Pfarrernachwuchs Gott, die beiden Testamente des alten Herrn, dazu Hebräisch, Moral, Kirchengeschichte usw., so wie andere Nachwuchskräfte unmittelbar daneben Physik, Betriebswirtschaftslehre oder Literaturwissenschaft erlernen; und keiner der Beteiligten denkt sich etwas dabei, geschweige denn etwas Böses. Nun ist der Theologie sicher kein Vorwurf daraus zu machen, wenn sämtliche anderen akademischen Disziplinen sich selbst so weitgehend als letztlich auf Glaubensannahmen begründete Weltanschauungen verstehen, dass die Nachbarschaft mit einem oder sogar zwei verschiedenen religiösen Bekenntnisfächern sie nicht geniert. Von bemerkenswerter Unehrlichkeit ist aber der Ehrgeiz der Kirchen, der Weitergabe und Fortschreibung ihrer frommen Verkündigung unbedingt die Form eines normalen akademischen Studiums und einer regulären Wissenschaft zu verleihen. Auf die Autorität des Scheins von Wissenschaft mögen sie nicht verzichten, um der Autorität ihres Gottes aufzuhelfen; und im Herrn Pfarrer soll die Gemeinde nicht zuletzt den studierten, nicht bloß durch den Heiligen Geist ausgewiesenen Geistlichen respektieren, obwohl – oder vielmehr weil – es doch bloß um den Entschluss zur Verabsolutierung des kindischen Traums von einer eigentlichen besseren Welt geht. Auf der Inkommensurabilität von Erkenntnis und Bekenntnis beharren Gottes Funktionäre auch wieder ganz selbstbewusst, wenn es etwa um die Besetzung der staatlich finanzierten Lehrstühle geht Da rangiert die bischöflich überprüfte Kirchentreue natürlich vor der Gelehrsamkeit. Ab dann soll aber eben doch der freie, quasitheoretische Einsatz des Verstandes das Seine zur Sicherheit des Bekenntnisses beitragen. Einige dutzend Generationen von bürgerlich denkenden Theologen haben es dabei zu bemerkenswerten Ergebnissen gebracht. Sie haben keinen Widerspruch ausgelassen, der dazu dienen kann, die paradoxe Einbildung einer absoluten Autorität, der die eigene Einbildungskraft angeblich nur gehorcht, durch alle Anfechtungen einer rationellen Selbstbesinnung des Denkens hindurchzusteuern. Mit welchem Einwand auch immer theologisch geschulte Kirchendiener/innen zu tun bekommen: Nie sind sie um eine Antwort verlegen, die den Schein, und zwar den staatlich beglaubigten, einer wissenschaftlichen Argumentation erweckt (bevor sie ihn dementiert) und damit – statt mit dem „Heiligen Geist“ – den Zweifel abtöten soll. Diese Gewissheit ist das Mindeste und meist das Einzige, was der Pfarrer aus seinen akademischen Semestern behält. Im Zeitalter der Wissenschaftsgläubigkeit ist sie unerlässlich; wenn nicht für den frommen Volksbetrug selbst, dann doch für ein gutes elitäres Gewissen dabei.
Beruf: Politiker
Wer in die Politik geht, darf mit Fug und Recht als Aussteiger bezeichnet werden. Er verlässt sein bürgerliches Gewerbe, vernachlässigt es teilweise oder ganz – aber nicht, weil er „null Bock“ in der Besichtigung seines Seelenstrebens ausgemacht hätte. Im Gegenteil, Leute, die in die Politik einsteigen, sind schwer motiviert. Sie fühlen sich berufen, die Staatsgeschäfte durch ihren persönlichen Einsatz und nach ihren Vorstellungen anständig und/oder ordentlicher zu verrichten. Ihr Entschluss hat eine sehr grundsätzliche Parteinahme für den Staat zur Grundlage, egal, ob die persönliche Note des Wirkenwollens mehr in Richtung „Recht und Ordnung“, „innerer Frieden“, „Gerechtigkeit“ oder „Ansehen der Nation in der Welt“ geht. Von den großen Linien der staatlichen Aufgaben, von den längst katalogisierten „Problemen“ der Politik sind Leute, die sich in ihr engagieren, allemal überzeugt. Die staatlichen Ämter sind ihnen samt ihren Zuständigkeiten bekannt, und zur Ausübung der einschlägigen Kompetenzen halten sie sich für kompetent. Es drängt sie, „Verantwortung zu tragen“ und mit ihrem Tun an der Ausübung der Staatsgewalt mitzuwirken.
Der Weg dahin, ins Amt, – das wissen die Aspiranten – führt in einer Demokratie über die Parteien (Mehrzahl!), so dass sie sich im politischen Verein ihrer Wahl und um ihn verdient machen. Da heißt es sich versammeln, abstimmen, reden und organisieren doch derlei Anstrengungen lassen sich als Opfer für die dringend erforderliche Politik abbuchen. Immerhin geht es erwiesenermaßen nicht um ein partikulares Interesse, sondern um den Handlungsbedarf des Allgemeinwohls. Dessen Erfolg steht nämlich auf dem Spiel, wenn es nicht die Richtigen, also man selbst, in ihre Obhut nehmen. Gefragt sind also Ideen, die zeigen, wie man sich auf den Umgang mit den Bürgern und ihren Interessensgegensätzen versteht. Diese Ideen verlangen dem Mann der Politik das Äußerste ab, trifft er doch in der von Wählern vollen Gesellschaft auf lauter konkurrierende Anliegen. Wo Geschäftsleute und Grundbesitzer Hindernisse auf dem Weg ihres ehrenwerten Erwerbs entdecken, gelangen Arbeitnehmer und Mieter ausgerechnet zur Behauptung von allerlei Ansprüchen und Lebensrechten. Rentner und Sportvereine, Gegner einer Umgehungsstraße und Befürworter einer Fußgängerzone liegen sich in den Haaren – und alle melden ihre Begehren bei der Instanz an, um deren Verwaltung sich ein Vertreter des Allgemeinwohls verdient machen will. Der wiederum kann an solch schwierigen Aufgaben nur wachsen. Er entnimmt dem Widerstreit der Interessen erst einmal die Wichtigkeit seines entscheidungsbeflissenen Engagements; und dass der Staat quasi selbstverständlich als Adressat für alle unzufriedenen Bürger gehandelt wird, lässt ihn endgültig seiner Verantwortung gewahr werden. So gibt er prinzipiell allen Anträgen recht, um sie dann nach Maßgabe der „Sachzwänge“ zu sortieren, in solche, denen er seine politische Förderung nicht versagen will, und andere, die er einfach nicht für „machbar“ hält und in die Schranken weist. Ganz locker – und nicht etwa, weil er Kapitalisten bevorzugt – gelangt er zu der Überzeugung, dass „die Wirtschaft“ das Letzte ist, was staatliche Beschränkungen verträgt. Denn von ihren Erfolgen hängt so gut wie alles ab: die Arbeitsplätze, die Beiträge für die Kassen, die den Kommunen verfügbaren Gelder, die Steuern, die Bautätigkeit usw. Und so fort. Echt überparteilich vergisst er bei seinen ablehnenden Bescheiden nicht hinzuzusetzen, dass er mit seinen Prioritäten allemal die Bedingungen schafft für die vorläufig zurückgestellten Maßnahmen.
Die seriöse Wahrnehmung der staatsmännischen Pflichten wird zwar etwas erleichtert dadurch, dass der Kanon der Ideen, in denen ein Politiker zu Hause sein muss, ziemlich fest umschrieben ist. Einerseits in den längst eingeteilten Ressorts, in denen sich Politiker in Kommunen, Ländern und Bund die Aufgaben der stets fälligen Staatsaktionen aufteilen. Andererseits durch den äußerst flexibel handhabbaren Gesichtspunkt, der dem Geld gilt. Ein ernstzunehmender Politiker prüft in der von ihm zu regierenden Gesellschaft alle Wünsche und Anträge genau. Dabei hütet er sich, einfach zu sagen, welchem Ansinnen er nachgeben will und welchem nicht. Rm Grunde trägt er Verantwortung für alle, und wenn er dann doch nicht unser aller Bestes tut, so kommt das allemal von den Beschränkungen her, die seinem guten Willen durch die Mittel des Staates auferlegt sind. Es gehört zum elementaren Handwerkszeug des Berufs, Geld für die unabdingbaren Aufgaben locker zu machen, um es an anderer Stelle wieder zur Verfügung zu haben. Natürlich liegt die Entscheidung darüber, was notwendig und was „leider“ nicht möglich ist, ganz in der Macht des Politikers; schließlich will er sie ja, die Macht, damit er diese Entscheidung treffen darf. Dennoch lässt sich an diesem Verfahren von demokratischen Amtsträgern ermessen, wie schwer sie an ihrer Verantwortung zu tragen haben. Sie entscheiden nicht nur, sondern begründen es auch noch ganz zuvorkommend dem Bürger gegenüber. Sie belehren alle unzufriedenen Landsleute unermüdlich darüber, dass Politik realistisch gehen muss und dass sie mit der Macht recht eigentlich einen Haufen Sachzwänge übernommen hätten, der sie immer wieder zur Ohnmacht verurteile.
So richtig schwer jedoch fällt die Vermittlung der politischen Vernunft, für die dieser Berufsstand geradesteht, wenn das Allgemeinwohl seine Vertreter vor die Alternative stellt, vor der sie sich am meisten scheuen: Die Rede ist von der Unterlassung einer von Bürgers Seite angeregten Maßnahme, und zwar aus dem schlichten Grund, weil das geltende Recht sie nicht zulässt. Dieser dem Rechtsstaat ergebenen Praxis werden nur wenige Demokraten, im Pochen aufs Recht geübt, ihr Misstrauen entgegenbringen. Auch dann nicht, wenn es andererseits immer wieder Maßnahmen ohne gültige Rechtsgrundlage gibt, die einfach sein müssen; ohne die der Staat nicht mehr das wäre, was er unter einer guten Führung zu sein hat: das unanfechtbare Lebensmittel für Jung und Alt, Wirtschaft und Arbeit, Studenten und Mieter, Frauen und Demonstranten. In solchen Fällen bleibt dem Politiker nichts anderes übrig, als das Recht zu ändern. Willkür ist ihm nämlich fremd, dem berufenen Sachwalter des Gemeinwesens. Entweder er hält sich ganz devot an die Gesetze – oder er macht sie so, dass sie seinem Auftrag entsprechen. In solchen Fragen ist nicht nur Mut, sondern auch Fingerspitzengefühl geboten, zumal die Setzung der Prioritäten ganz in das Ermessen des Staatsmannes fällt, dem – das soll hier nicht verschwiegen werden – längst auch Staatsfrauen heftig Hilfe leisten und Konkurrenz machen. Und die Konkurrenz um die Macht findet ja zudem immerzu so statt, dass einmal Gesetzestreue, das andere Mal gesetzgeberischer Handlungsbedarf eingeklagt wird.
Die charakterliche Eignung für den Beruf des Politikers ist also so ohne gar nicht. Es bedarf eines ausgeprägten Willens zur Macht, der Überzeugung, dass es am besten ist, anderen Leuten vorzuschreiben, wo’s lang geht. Diese Sicherheit, man wüsste sehr genau Bescheid über die „Rahmenbedingungen“ und die Ordnung, die im Grunde jedermanns Interesse entsprechen oder es in die richtigen Bahnen lenken, ist aber nur die halbe Miete. Hinzu kommt die tiefe Einsicht, dass man es garantiert nicht jedem recht machen kann – also eine selbstkritische Bescheidenheit, was die Wirkung auf die mit Politik beglückten Leute angeht. Zweifel allerdings am Sinn des erbrachten Opfers, an der eigenen Mission gar sind auch wieder nicht förderlich – sie lähmen die Entscheidungskraft, die das Amt gebietet. Allenfalls ringen sie sich zu der Erkenntnis durch, dass sich die mit dem Amt erworbene Macht an Sachzwängen bricht, die der Handlungsfreiheit Grenzen ziehen. Diese Erkenntnis lässt sich auch gut an enttäuschte Wähler weitergeben; teils mit dem Ausdruck des Bedauerns, teils in Form tatkräftiger Belehrung von Kritikern, die einsehen müssen, dass ihre Alternativen nicht realistisch sind, also in der Politik nichts zu suchen haben.
Die Fähigkeit zum Lernen ist mithin eine unabdingbare Voraussetzung für den politischen Beruf. Erlernt werden muss der Maßstab des Staates, der sich von allen privaten Interessen in der Gesellschaft gründlich unterscheidet. Daraus ergibt sich auch der Kern des Selbstbewusstseins, ohne das ein Politiker nicht weit kommt: Die Erledigung des politischen Geschäfts ist die Bedingung dafür, dass alle anderen Geschäfte – von den diversen Arten des Erwerbs übers Heiraten bis zur Meinungsäußerung überhaupt gehen. Diese Ausnahmestellung verpflichtet einen verantwortungsbewussten Politiker darauf, von seinem Recht Gebrauch zu machen und zu bestimmen, wie die Regierten ihre Interessen zu verfolgen haben und welcher Mittel sie sich dabei bedienen dürfen. Eine gewisse Erleichterung bei dieser schweren Aufgabe bieten dem Politiker da die Artikel des Grundgesetzes, durch die wenigstens schon einmal die grundsätzlichen Erwerbsquellen Eigentum und Arbeit festgelegt sind. So können sich die Staatsleute darauf konzentrieren, die Konsequenzen, die daraus folgenden Gegensätze zu regeln. Streng nach dem Gleichheitsgrundsatz verfügen sie, was jedermann zu tun und zu lassen hat. Ihre gesetzlichen Richtlinien und die Aufsicht ihrer Befolgung betreffen das Bankgewerbe ebenso wie den Rhein und die Arbeitslosen. Und wenn die Segnungen des politischen Wirkens in sehr unterschiedlichen Lebensverhältnissen ihren Niederschlag finden, wenn Rechte und Pflichten, Reichtum und Armut etwas kontrastreich verteilt sind, so liegt das nicht an der Verletzung des Gleichheitsprinzips durch den Staat, sondern an der Gleichbehandlung, die die Regierung den unterschiedlich bemittelten Bürgern zuteil werden lässt. Und die Verfassung ist ohnehin unantastbar, mithin auch die Abhängigkeit von allem und jedem, sogar der Politik, von „der Wirtschaft“.
In diesem Sinne ist die Leistung der Menschen, die sich der Politik verschreiben, gar nicht hoch genug einzuschätzen. Sie machen sich allen Ernstes das Allgemeinwohl zu ihrem privaten Lebensauftrag Sie nehmen es auf sich, allen anderen Bürgern, deren politisches Engagement sich im Abgeben von Wählerstimmen erschöpft – die Richtlinien ihres Handelns zu präsentieren. Und das nicht aus Eigennutz, sondern nur mit dem Gelingen des Gemeinwesens im Kopf. In dessen Gestaltung investieren sie ihre ganze Kraft, und als ihren persönlichen Erfolg kennen sie nur den Erfolg des Staates, dem sie dienen. Sie kümmern sich um die Landesverteidigung, obwohl sie selbst gar keine Soldaten sind; um die Ladenschlussgesetze, obwohl sie selbst gar keinen Laden haben; um das Streikrecht, obwohl sie selbst nie streiken wollen; um die Sittlichkeit der Familie, obwohl ihre eigene Familie unter der Bürde ihres Berufes leidet; um die Menschenrechte im Ausland, obwohl sie dort gar nicht leben. Kurz: Sie betätigen sich freiwillig als Charaktermasken ihres Staates, dessen Fortkommen den ganzen Inhalt ihrer Karriere ausmacht. Insofern geht es sicher auch in Ordnung, dass sie nicht darben und von Gesetzes wegen vorgesehen ist, dass sie im schäbigen Rest ihres Privatlebens nicht zu kurz kommen.
Fragwürdig hingegen erscheint die Last, die sich diese noblen Leute mit der Regierungsform der Demokratie aufgebürdet haben. Als wäre der Entschluss, ganz in den Sorgen der politischen Gewalt aufzugehen, kein hinreichender Ausweis für die moralische Befähigung zu den verantwortungsvollen Ämtern; als wollten sie im Bewusstsein ihrer Ausnahmestellung als Elite unter den Staatsbürgern, die sich ja mehrheitlich nur ihrem privaten Glück widmen, wirklich nur die Besten unter sich mit dem höchsten Staatsdienst betrauen, halten sie daran fest, dass Konkurrenz auch der Politik nur nützen könne. Und sie überlassen die Entscheidung darüber, wer Staat machen darf, zu allem Überfluss den vielen Bürgern, die wegen ihrer eigennützigen Einstellung eher unzufrieden mit den Leistungen der Politik sind. In Parteien organisiert verpflichten sich die Vertreter des politischen Standes darauf, sich untereinander zu messen. Von derselben Sorge getrieben, vom selben Staatsgeist und vom einzigen Gedanken an gute Regierung beseelt, erlegen sie sich die harte Prüfung auf, sich vom Wähler und dessen launischen Vorstellungen vergleichen zu lassen. Die Folgen sind nur allzu bekannt: Streit entbrennt ausgerechnet unter denen, die dasselbe wollen; dazu verdammt, sich auch noch unterscheiden zu müssen, machen sich engagierte Demokraten daran, ihre Einigkeit in der Sache in Frage zu stellen. Und zwar durch lauter Techniken, durch die sie sich vor den ihnen gleichgesinnten Aspiranten auf die Macht auszeichnen: Das Leben wird zum Wahlkampf.
Mit der unbeirrbaren guten Meinung von sich, ein bisschen zum Führen das Zeug zu haben, ist es nämlich noch lange nicht getan. Auf die Idee, dem Angebot der Parteien zu folgen, kommen jede Menge Leute; und wenn irgendein Verein über seine „dünne Personaldecke“ Beschwerde führt, geht es hauptsächlich um national respektable Zugpferde, die beim Wähler so ankommen wie erfolgreiche, aber abtretende Retter des Vaterlandes. So finden sich schon extrem junge Menschen mit allerlei „Konzepten“ im Kopf bei den Parteiorganisationen ein, die für die Rekrutierung auf der einen, für die Präsentation der Partei auf der anderen Seite unterhalten werden. Die „Konzepte“ haben sie gewöhnlich aus dem zirkulierenden Ideengut der politischen Hauptrichtungen, und ihre jugendliche Unerfahrenheit beweisen sie weniger dadurch, dass sie den Staat als die einzig realistische Chance ansehen, um ihren Tatendrang hin zur „Weltverbesserung“ geltend zu machen; vielmehr dadurch, dass sie die Staatsvereine noch auseinanderhalten können. Das ist den arrivierten Betreuern des Parteinachwuchses sehr recht, weil jede Partei einen kleinen Unterschied braucht, mit dem sie statt der anderen den Zuspruch der Wähler einheimst. Hinzu kommt, dass der jugendliche Eifer – ganz gleich, ob er sich in der Jungen Union oder bei den Jungsozialisten betätigt – stets als Ausdruck der Unzufriedenheit und als Wille zur Veränderung daherkommt. Diese Verwechslung des politischen Regelungsbedürfnisses mit dem Bemühen, gute Werke zu tun, ist enorm brauchbar.
Dennoch werden die Aktivisten des Parteilebens weniger mit Komplimenten bedacht als einem Test unterzogen, und zwar von ihresgleichen wie von den Altgedienten. Ihre Brauchbarkeit für die Partei wird ihnen als das Kriterium ihres Erfolgs nahegelegt. Dabei spielt das Abschleifen ihrer idealistischen Gesinnung am schwer dialektischen Verhältnis von wünschbar/machbar seine Rolle, nicht minder die Einsatzfreude und wählerwirksame Wirkung aufs Publikum. So machen die Jungpolitiker aus der studierenden Jugend, die ohnehin wie ein Sozialkundelehrbuch denkt, dieselben Erfahrungen wie die, welche die ideologischen Launen eines gewerkschaftlich orientierten Elternhauses ins politische Engagement verschlagen haben: Sie müssen durch ihre Mitarbeit beweisen, ob sie bloße Anhänger der Partei sind und bleiben wollen – oder zu mehr bereit und fähig.
Die meisten haben eben die Zeit und den unbändigen politischen Willen doch nicht, die für die erste Zeit fällige „Doppelbelastung“ von Beruf und Politik zugunsten letzterer zu entscheiden. Gesucht wird also nach denen, die laut „Hier!“ schreien, wenn einer der nicht zu knappen – Posten zu vergeben ist. Wer zum Schriftführer im Ortsverband Eichstätt-Süd gedrängt werden muss, taugt nicht viel – auch wenn er den Posten doch annimmt –: Er zählt dann unter die „treuen Seelen“. Wer aber den Schriftführer macht, weil er sich gute Chancen auf den 2. Ortsverbandsvorsitzendenposten ausrechnet, den mag die Partei gut leiden. Man konstatiert „gesunden Ehrgeiz“ und ein für die Partei nützliches Karrierestreben – „der Mann/die Frau scheut nicht vor der Drecksarbeit zurück“. Ab sofort gibt es jemanden, der ihn/sie im Auge behält“. Das sieht dann so aus, dass dem jungen Mann/der jungen Frau häppchenweise immer mehr Verantwortung in der Partei und im „öffentlichen Leben“ übertragen wird.
In der Partei heißt es, sich gegen die Konkurrenten in den Eigenen Reihen durchzusetzen und die Durchsetzung der Partei gegen die anderen Parteien zu befördern. Diese beiden Aufgaben müssen Hand in Hand gehen; denn nur wenn man in der Partei nach oben kommt, kriegt man die Posten, und nur wenn man die Partei an die Macht bringt, gibt es die Posten. Diese Regel gilt für den Gemeinderat an der Fulda genauso wie für den Listenplatz bei den Wahlen zum Landesparlament oder zum Bundestag.
Gelernt wird dabei vor allem eines: dass in einer politischen Karriere Taktik, also Berechnung das Denken anzuleiten hat, so dass es sich umgekehrt darstellen lässt. Eine gewisse Festigung des Charakters bleibt da nicht aus, und nach ein paar Jahren Parteiarbeit gilt die Frage nach attraktiven Themen und Problemen als der Inbegriff politischen Sachverstandes.
Da sich das alles nur aufgrund einer Überzeugung von der eigenen und der Partei Mission machen lässt, ist der Verdacht des Opportunismus völlig fehl am Platz. Selbst die Kritik, die gelegentlich eines Misserfolgs natürlich fällig ist und ebenso natürlich auch „personelle Alternativen“ ins Spiel bringt, hat ja nur den Erfolg der gemeinsamen Sache im Auge. Sie ist ebenso solidarisch wie die rückhaltlose Unterstützung eines Vorsitzenden, dem die in einer Wahl gewonnenen 2 % unwidersprechlich recht geben. Sein Verdienst ist unübersehbar, ebenso wie die positive Wirkung des Programms nur dessen Qualität beweist. Umgekehrt sind widrige politische Konjunkturen nur der Index dafür, dass ein Programm neuen Typs her muss. Wer sich nach einer Wahlniederlage nicht zu einem wenigstens ein bisschen grundsätzlichen Umdenken herbeilässt, dem geht es eindeutig nicht um die Sache, um die es geht.
Die Karriere im Staat ergibt sich mit dem Erfolg. Einer, der sich in der Partei bewährt, wird von ihr mit der Wahrnehmung von Staatsgeschäften betraut. Je mehr einer in ihr nach oben kommt, desto klarer, dass er zu einem Gebrauch der Staatsgewalt taugt, der wiederum der Partei in Form von Stimmen zugute kommt. Das läuft natürlich auch umgekehrt: Wer sich auf dem ihm anvertrauten Posten bewährt, empfiehlt sich in der Partei für höhere Aufgaben.
Der Befehl über die rechtmäßige Staatsgewalt beginnt beim „kleinen“ Kreisverwaltungsreferenten, der im Namen des städtischen „Erscheinungsbilds“ Stadtstreicher, Prostituierte und Maßkrüge so verwaltet, dass die penible Einhaltung noch der letzten Detailvorschrift dem Bürger als „Grundlage des Zusammenlebens“ nachdrücklich eingeschärft wird; und endet beim Bundeskanzler, der mit einem einzigen Beschluss Millionen verarmen oder in den Krieg schicken kann. Die Karriere ist ablesbar am Umfang der Gewalt, die ihm anvertraut wird.
In den höheren Rängen der parteipolitischen Hierarchie hat es zwar mit der Konkurrenz kein Ende. Immerhin aber steht fest, dass die wesentlichen Härtetests der politischen Karriere bestanden sind. Wer für einen Ministerposten oder gar für die Kanzlerkandidatur in Frage kommt, ist ein Staatsmann. Das sieht jeder schon daran, dass die Person „im Gespräch“ ist, von Meinungsumfragen und den Medien betreut wird, so dass ihre Vorstellungen als eine Variante des gültigen Nationalbewusstseins zählen.
Das ist nicht verwunderlich. Was immer man/frau gegen eine Figur solchen Kalibers einwenden mag – unbestreitbar bleibt, dass sie nicht zufällig, sondern durch den Respekt des Wählers dort angekommen ist, wo sie steht. Diesen Respekt muss sie sich verschafft haben, was, in die vorzügliche Eigenart der Person übersetzt, „Durchsetzungsvermögen“ genannt werden kann. Diese seine Leistung nimmt sich ein Politiker der ersten Garnitur ohne falsche Selbstzweifel, aber auch ohne Überheblichkeit zu Herzen. Er weiß, dass er nicht ruhen noch rasten darf, wenn er sich nicht am Sinn und Zweck seiner Mühen vergehen will. Er treibt nicht einfach Politik, sei es auf der Regierungs- oder Oppositionsbank, sondern kümmert sich unermüdlich um seine Glaubwürdigkeit.
Das ist nicht ganz einfach, obwohl es geht. Selbstdarstellung ist nämlich keine Aufforderung zur Prüfung dessen, was man tut. Eher die Erinnerung daran, dass einem der Erfolg recht gibt. Und die Aufforderung, die Führung der Nation dem zu übertragen, der garantiert nichts anderes vorhat. Insofern ist der Beruf des Politikers doch nicht so schwer. Zumindest so lange nicht, wie so einer darauf setzen kann, dass die Wähler wirklich kein anderes Problem haben als er selbst: eine gute Führung. Dann ist auch das Selbstlob der Charaktermaske das Argument für ihre Ermächtigung.
Beruf: Professor der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften
Das ist schon ein seltsamer Luxus: Da unterhält der moderne Staat einen ganzen Stand von Professoren und akademischen Hilfskräften mit dem einzigen Auftrag, professionell über ihn und das Tun und Lassen, Denken und Treiben seiner Gesellschaft nachzusinnen – und das alles überhaupt nicht zu dem Zweck, dass er oder sonst irgend jemand sich nach den etwa ermittelten Erkenntnissen richtet. Politiker und Lohnarbeiter, Ladenbesitzer und Unternehmer, Bauern und Bauherren wissen, was sie zu tun, nach welchen Zwecken und Mitteln sie sich zu richten haben; die Notwendigkeiten resp. Freuden des Geldverdienens belehren praktisch und unwidersprechlich darüber Sie wollen sich nicht und sie sollen sich auch gar nicht erst geistes- und gesellschaftswissenschaftlich belehren und überzeugen lassen. Von den zahllosen „Expertenkommissionen“, mit denen politische Parteien und Gewerkschaften, Unternehmerverbände und Ministerien sich gerne umgeben, weiß jeder – der Auftraggeber schon gleich –, dass sie keine Wahrheiten zutagefördern, die fortan beherzigt werden, sondern dass sie längst feststehende gesellschaftliche Interessen mit passenden Interpretationen bedienen. Quizsendungen, in denen ein leibhaftiger Professor darüber entscheidet, ob die Wahnsinnstaten eines gequälten Gedächtnisses einen Punkt verdienen oder nicht, sind vielleicht die einzigen Gelegenheiten, bei denen Gelehrsamkeit über ein Stück gesellschaftlicher Realität entscheidet – über ein paar Tausender in dem Fall.
Die praktische Bedeutungslosigkeit des Nachdenkens und Forschens von Geisteswissenschaftlern ist eine gesellschaftliche Tatsache. Die Gelehrtenwelt gesteht sich das aber als ihre Geschäftsgrundlage nur ungern ein, obwohl sie sich nach ihr wie nach einer verbindlichen Maßregel richtet. Sie ist übereingekommen, ihr Metier, nämlich „Theorie“, als eine Angelegenheit zu betrachten, die für „die Praxis“ nie und nimmer umstandslos taugen kann. Wissenschaft könne und wolle keine Vorschriften machen, heißt es; und eine ganze Spezialabteilung zeitgenössischer Geisteswissenschaft ist mit dem immer erneuten Nachweis beschäftigt, dass es von wissenschaftlichen Urteilen zu Imperativen keinen Übergang gebe.
Mit dieser dogmatischen Selbstbeschränkung verrät die Zunft zweierlei. Zum einen, wie fremd ihr die Verstandestätigkeit ist, die den Namen „Theorie“ verdient, nämlich wissenschaftliche Erkenntnisse hervorbringt. Derartiges Begreifen steht zum Willen der Leute und ihrem praktischen Tun gar nie im Verhältnis der Vorschrift, die respektvollen Gehorsam verlangt – wie die Geisteswissenschaftler zu befürchten vorgeben –, sondern – viel schlimmer! – es klärt über Grund und Zweck der Vorschriften auf, die per Gehorsam die gesellschaftliche Praxis regeln; es zersetzt damit deren Autorität und unbegriffene Gültigkeit und dadurch den gesellschaftlichen Gehorsam. Praktisch wirksam wird es nicht als Imperativ, sondern ganz von selbst in dem Maße, wie die Leute es mitvollziehen und die angebotenen Einsichten als die Wahrheit ihrer Lebenslage erkennen. Zum andern verraten die Gelehrten in Sachen Geist & Gesellschaft mit ihrer „bescheidenen“ Auffassung von Theorie und ihrem Dogma von der unpraktischen Natur des Denkens, wie geläufig ihnen eine gesellschaftliche Praxis ist, welche „Vernunft“ prinzipiell nur als Imperativ, als autoritative Vorschrift kennt. Sie wissen gar nichts anderes als eine Welt, in der die Gültigkeit einer Aussage gleichbedeutend ist mit einem Befehl; wo man daher bei jedem Geistesblitz nach der Autorität fragt, die dessen Geltung verbürgt, und dabei natürlich den ordentlichen Instanzenweg einhält – und auf dem kommt ein so antiautoritäres Ding wie wissenschaftliche Erkenntnis nirgends vor.
Diese Sorte Praxis lässt die bürgerliche Gelehrtenwelt sogar ganz fraglos als das Prinzip gelten, nach dem sie selbst als Berufsstand organisiert ist. Die Figur des Privatgelehrten, der mit nichts als seinen Einfällen und Argumenten auf sich aufmerksam macht, ist aus dem professionellen Betrieb verschwunden, welcher sich direkt in Gegensatz zu solchem „Dilettantismus“ als seriös definiert.
Die Zugehörigkeit zur respektablen Wissenschaft verbürgt ein vom Staat verliehenes Amt. Sie wird erworben und vollzieht sich als Beamtenlaufbahn, über die vom Staat berufene Vorgesetzte nach den Regeln amtlicher Eignungsprüfungen entscheiden, unter denen nebenbei die Verfassungstreue obenan steht. Die Laufbahnerfolge werden auf wissenschaftlichen Werken und Lehrbüchern als Empfehlung vermerkt; denn sie sind gleichbedeutend mit der wissenschaftlichen Reputation des Autors. Diese Gleichung wird kein bisschen dadurch beeinträchtigt, dass jeder, insbesondere jedes Mitglied der wissenschaftlichen Beamtenschaft, den entscheidenden Einfluss von Beziehungen, Protektion und Intrigen auf die Laufbahn eines Gelehrten kennt: Bei einer Amtsautorität zählt letztlich nicht, wie sie einer erworben hat – höchstens für die unverbindliche Privatmeinung über den Amtsinhaber.
Dass das Nachdenken über Geist und Gesellschaft sich so problemlos als Zweig des öffentlichen Dienstes organisieren lässt, hat seine Grundlage in der Sache. Zersetzende Aufklärung über die gesellschaftliche Natur von Werten und Ideologien, Arten des Lebensunterhalts und politischer Macht, Recht und Moral wird nicht nur öffentlich als übertriebener, unzulässiger theoretischer „Anspruch“ abgelehnt; eine solche Tätigkeit ist auch aus der Berufstätigkeit selbst, der Professoren und sonstige Universitätsangehörige nachgehen, getilgt. Statt mit ein paar Erkenntnissen und deren Weitergabe ist das Gelehrtentum mit einer Verstandestätigkeit anderer und ganz eigener Art befasst: Man erstellt gedankliche Bilder des jeweiligen Gegenstandes, die gewissen Kriterien genügen und darüber Billigung finden sollen. Die Kriterien, an denen ein solches Geistesprodukt gemessen sein will, stehen in ganz allgemeiner Form fest: Tiefe, Originalität, methodische Durchdringung des Stoffs, Bezugnahme auf konkurrierende Darstellungen. Worauf sie im besonderen hinauswollen und nach welchen Maßstäben ihre Deutung selber beurteilt werden will, möchten solche Werke selbst angeben. Es ist nicht ihre wissenschaftliche Gültigkeit, die ihren Erfolg bestimmt, sondern es ist die Aufnahme, die sie und die von ihnen „gesetzten Maßstäbe“ praktisch finden, wonach ihre wissenschaftliche Gültigkeit sich richtet – so wandeln sich nebenher die Kriterien für Wissenschaftlichkeit. Inzwischen gilt es als seriöse Definition einer Wissenschaft, auf die Summe des Unsinns zu verweisen, den die entsprechend ausgewiesenen Lehrstühle produzieren, und nicht als ironische Glosse auf ihren Verfall. Das Ergattern von Lehrstühlen, die Publizität einer „Theorie“, am besten die Bildung einer „Schule“, kurzum: der Erfolg im Reich der Wissenschaftler und ihres Geschmacks ist das Kriterium für die Wissenschaftlichkeit eines vorgelegten Deutungs-„Vorschlags“ und nicht umgekehrt.
Dementsprechend sieht auch die Weitergabe wissenschaftlicher „Leistungen“, die akademische Lehre aus. Sie verlangt von den Studenten alles andere als die Prüfung von Theorien, die Ermittlung ihrer Wahrheit bzw. ihrer Fehler. Sie bietet im Gegenteil den Bestand an anerkannten Bildern eines Gegenstandes zur gefälligen Kenntnisnahme, welche mehr mit Auswendiglernen als mit Nach-Denken zu tun hat; auf höherer Stufe übt sie die zu breiterer Anerkennung gelangten – oder danach strebenden – Methoden der fachspezifischen theoretischen Malkunst ein, trainiert also in einer Art Denksport. Was so auf alle Fälle vermittelt wird, ist der Aberwitz eines wahrheitsfreien Theoretisierens: die Gewohnheit und Geläufigkeit, „weil“- und „so dass“-Sätze, der Form nach also Urteile und Schlussfolgerungen zu äußern, ohne sie als Urteil oder Schlussfolgerung über die verhandelte Sache zu meinen. Die Kunst, so zu „denken“, erlaubt einen erfolgreichen Studienabschluss und in Ausnahmefällen den Übergang dazu, sie produktiv, zur Erstellung eines noch nicht dagewesenen kleinen Gedankengebäudes, anzuwenden; damit beginnt die Laufbahn des wissenschaftlichen Nachwuchses – sofern ein Amtsinhaber sich ihrer annimmt.
Mit der Einrichtung des professionellen Gelehrtenwesens leistet sich der moderne Kulturstaat einen Denkbetrieb, der sein Maß und Ziel in nichts als seiner Eigene Betriebsamkeit hat. Dieser Betrieb lebt von der Unaufhörlichkeit des gedanklichen Konstruierens, des konstruktiven Vergleichens der Ergebnisse, der Konstruktion von Vergleichsgesichtspunkten usw. – ohne dass jemals eine kleine Erkenntnis eine Bibliothek verkehrter Deutungen überflüssig machen könnte. Außer ihren selbstgesetzten Aufgaben kennt diese Betriebsamkeit noch nicht einmal die dem „normalen Menschenverstand“ geläufigen Kriterien des Wichtigen und Unwichtigen. So bietet die Welt der Universitäten das lächerliche, doch hoch in Ehren gehaltene Schauspiel zahlloser erwachsener Menschen, die Jahre ihres Lebens mit der erbittert verteidigten „Analyse“ einer Handvoll Gedichte verbringen; oder mit der Streitfrage, ob die Pyramide oder die Zwiebel das passendere Modell für eine „mobile Gesellschaft“ sei; oder mit mathematischen Theorien eines ökonomischen Fließgleichgewichts, deren sämtliche „Faktoren“ sich einer Definition verdanken, die deren Tauglichkeit für die Erstellung einer mathematischen Theorie im Auge hat und sonst nichts; oder mit der Sammlung von Quellen zur mittelalterlichen Theologie des Schutzengels; oder …
Bei dieser Beschäftigung kennt die Gelehrtenwelt allerdings keinen Spaß. Sie macht damit – das ist der einzige inhaltliche Gesichtspunkt ihres Tuns – ein geistiges Verhältnis zu allen Gegenständen der gesellschaftlichen Praxis, den wirklichen, vielen vergangenen und zahllosen erfundenen, praktisch wahr, das sonst im modernen Leben nur als ideologisches Kompliment an die Tätigkeit vor allem der herrschenden Figuren in Staat und Wirtschaft vorkommt: Sie übt Verantwortung.
In sämtlichen praktischen gesellschaftlichen Verhältnissen ist es eine lügnerische Schönfärberei, wenn behauptet wird, Tun und Trachten der Agenten wäre durch hingebungsvolle Sorge um Ordnung, Werte – nicht finanzielle, sondern solche der ideellen Art –, Sinnprinzipien, moralische Grundsätze oder sonstige Abstraktionen eines verfeinerten Rechtsempfindens bestimmt oder womöglich begründet. „Arbeitgeber“ achten auf den Profit ihres Unternehmens und nicht auf die Ideologie, auf die sie getauft sind, aufs Vergeben von Arbeitsplätzen; Politiker kennen und beschwören das „Gemeinwohl“ als Rechtstitel des staatlichen Machtmonopols und ihres erfolgreichen Besitzes desselben; Militärs schätzen „Kameradschaft“ als den schönen Schein einer durch Zwang und Gehorsam hergestellten Notgemeinschaft; dasselbe gilt für sozialministerielle Erinnerungen an die „Solidarität, zwischen den Generationen z. B. oder mit den Arbeitslosen; und schon jedes Kind der bürgerlichen Gesellschaft weiß demonstrative Bravheit berechnend als Mittel für kindische Gaunereien einzusetzen. Die Prätention, letztlich durch die Erfordernisse eines sinnreich-sinnstiftenden Allgemeinen motiviert zu sein und nie „bloß“ durch eigene Interessen – die deswegen „Egoismus“ heißen –, ist die selbstverständliche, durchschaute, aber geltende Heuchelei, mit der Anliegen von ganz anderem Strickmuster – die mit dem Interesse an einem hohen Einkommen auch nicht einfach zusammenfallen – sich feiern oder um Anerkennung und Geltung streiten.
Anders im Reich der Wissenschaft. Was der Gelehrtenstand den Gegenständen seines Bemühens als deren „Theorie“ hinzufügt, sind gar keine verleugneten materiellen Interessen, sondern gleich deren Ehrentitel: lauter Ordnungs-, Wert-, Sinnstiftungs und Rechtsgesichtspunkte, die mit dem jeweiligen Objekt seiner Neugier zur Debatte stehen sollen. Der Ernst, mit dem Geistes- und Gesellschaftswissenschaftler solche Gesichtspunkte aufstellen und ihrem Gegenstand zuschreiben, mag geheuchelt sein und ein innerwissenschaftliches Karriereinteresse verraten. Der Job selbst jedoch, den sie mit ihren Vorträgen, Büchern, Aufsätzen usw. Verrichten, hat keinen anderen Inhalt als eben den, rein fiktiv diejenige Haltung zur Welt und ihren wirklichen oder angeblichen Einzelteilen einzunehmen und in Gedanken durchzuspielen, die die heuchlerische Manier bürgerlicher Interessensvertretung ausmacht – rein fiktiv und dabei so, als läge darin die Wahrheit aller wirklichen Verhältnisse. Sie denken den Kapitalismus als Problem der Versorgung der Leute mit Arbeitsplätzen modellmäßig durch; sie leiten die politische Gewalt als Erfordernis des größten Glücks der größten Zahl ab; sie konstruieren Krieg als Gemeinschaftserlebnis durch; sie erörtern die Rentenkasse als Lösung des interkulturellen Problems altersspezifischer Arbeitsteilung; sie fingieren Kindheit als die Mühsal des Gesellschaftlich-Werdens schlechthin usw. So „verantworten“ sie jeden Gegenstand in dem buchstäblichen Sinn, dass sie mit all ihren theoretischen Bildern von ihm diejenige Frage nach seinem höheren Sinn, seiner tieferen Bedeutung und gründlichen Rechtfertigung beantworten, die sonst nur zum Zwecke moralischer Selbstdarstellung eines verlogenen Materialismus aufgeworfen wird – selbstverständlich nie so umständlich, raffiniert und methodisch reflektiert aufgeworfen wird, wie der Gelehrtenstand sie beantwortet.
Kurzum: Im modernen Kulturstaat erklärt ein ganzer Berufsstand in weiträumigen Bibliotheken und den zahllosen Veranstaltungen eines regen Geisteslebens jede Heuchelei in Bezug auf gesellschaftliche Interessen, Zwecke und Einrichtungen zu deren eigentlichem Wesen und erfindet nach diesem Strickmuster beständig neue „Wesenszüge“, ohne sich daraus groß ein Gewissen zu machen. Dabei strengen sich die Professoren und ihre Assistenten sehr an. Diese Anstrengung gibt ihnen das offenbar ungemein beruhigende Bewusstsein, kein luxuriöser Schnörkel an der bürgerlichen Klassengesellschaft zu sein, sondern allen Ernstes das, als was sie organisiert sind: öffentlicher Dienst.
Ob irgendwer in der Gesellschaft oder ein Staatsorgan von den Interpretationsangeboten aus der Werkstatt der Wissenschaftler Gebrauch macht, steht dahin, spielt für den Nutzen dieser luxuriösen Albernheit aber gar keine Rolle. Dieser ist prinzipiellerer Natur. Das professionelle Gelehrtentum verbürgt allein durch seine umfängliche, kostspielige, unübersehbare und ehrwürdige Existenz die Geltung der Lüge, alles in der Gesellschaft wäre wohldurchdacht und Nachdenken ginge gar nicht anders als so, dass alles und jedes verantwortet wird. So ist der Gelehrtenstand die vom Staat gekaufte und organisierte leibhaftige Widerlegung zersetzender Wahrheiten. Mit seiner Ausbildungstätigkeit legt er auch jeden nachwachsenden Verstand auf konstruktive Gesinnung statt Erkenntnis fest.
Diese Leistung ist in so totaler Weise nicht zu haben ohne Bibliotheken voller Unsinn, der den Bereich innerwissenschaftlicher Selbstbespiegelung nie verlässt. Eben deswegen sind sogar diese Unkosten äußerst nutzbringend angelegt.
Beruf: Programmierer
Software zu fabrizieren, zählt unumstritten zu den fortschrittlicheren Tätigkeiten, durch deren Ausübung sich ein moderner Geist nützlich machen kann. Mit beiden Beinen steht der Programmierer in der Zukunft namens „Computerzeitalter“, welche dem Vernehmen nach dazu angetan sein soll, „unser ganzes Leben, sogar das geistige, in grundlegender Weise zu verändern“.
Solches Gerede von einer ungeheuren Wirkung, die sein Gerät auf „Mensch und Gesellschaft“ ausüben soll, überlässt der Softwaremann in der Regel gern den notorisch um den Stand der Werte besorgten Zeitgenossen; als „Spezialist“ wird er dafür bezahlt, dass er sich ganz auf die tatsächliche Materie seines Jobs konzentriert. Diese besteht in Datenverarbeitung, d. h. ihrem Inhalt nach in Verrichtungen, für die die überbezahlte Arbeitszeit eines Sachbearbeiters, einer Schreibkraft oder anderer Verwaltungsfiguren neuerdings als zu schade gilt, als dass diese sich weiterhin damit belasten sollten: dem Ablegen, Sortieren, Aktualisieren und zweckmäßigen Bereitstellen aller möglichen Details, die seit eh und Je die Ordner und Karteikästen einer Unternehmung oder Behörde füllten, weil diese sie für die geregelte Abwicklung ihres Geschäfts benötigt – vom Firmeneintrittsdatum des Pförtners bis zur Höhe steuerfreier Zuwendungen an die FDP pro Geschäftsjahr.
Darüber, welchen rechtlichen Bestimmungen oder kalkulatorischen Absichten dadurch Genüge getan werden soll, braucht sich der EDV-Mann genausowenig den Kopf zu zerbrechen wie jeder andere Bürohengst; so wie er die „Daten“ selbst vorfindet, so wird ihm auch genau gesagt, wie er dieselben zu organisieren habe, damit sie für die jeweils eingerichteten Bestellabwicklungs-, Bestandhaltungs-, Lohnabrechnungs-, Gewinnbilanzierungs- und anderen Verfahren am effektivsten verfügbar sind. Die „Entscheidungsebene“ ist schließlich beim Management gut aufgehoben; Aufgabe des Programmierers ist hingegen zu gewährleisten, dass diejenigen untergeordneten Verrichtungen, die nur noch in der sturen Ausführung vorgegebener Bearbeitungsroutinen bestehen, nunmehr auch gänzlich ohne den letzten Rest von gedanklichem Aufwand, nämlich vollautomatisch vonstatten gehen können. Die einzig nennenswerte Wirkung, die hiervon ausgeht, ist die, dass sich die Gehaltsliste seiner Firma um diverse Positionen erleichtert. Die Büromenschen werden also nicht von der stupiden Aktenordnerei und Buchführung befreit, sondern gleich selber, soweit die Bildschirmbedienung es erlaubt, eingespart. Für die Restlichen ist die Arbeit am Terminal um so aufreibender.
Dasselbe gilt für die „aufregenden“ neueren Anwendungen von Computern in der Fabrikation. Der besteckende Vorteil rechnergesteuerter Apparate, unermüdlich gleichförmig und genau zu werkeln und das auch noch schnell, hat dem Beruf des Programmkonstrukteurs neue Aufgabenfelder erschlossen: Wo die Arbeit der „Gewerblichen“ schon in nichts anderem als dem sturen Befolgen von Bedienungsvorschriften besteht, da liegt es nahe, die Bedienungsvorschriften gleich selbst und dann gleich radikal zum steuernden elektronischen Mechanismus zu vergegenständlichen. Dass das bloß die Firma freut und die alten Bedienungsmannschaften bloß die blöde alte Einkommensquelle kostet, geht den Programmierer wirklich nichts an. So wie er auch nichts dafür kann, wenn andere Auftraggeber das scharfe Auge und die sichere Hand ihrer Panzerschützen oder Bomberpiloten durch Superchips ersetzt haben möchten, die, mit der richtigen Software versehen, Vernichtungsgerät präzise ins Ziel führen. Er dient ja bloß – so wie die Inhaber der Fähigkeiten, die die von ihm eingerichteten Apparate überflüssig zu machen gestatten.
Die Anerkennung, die dieser „junge“, vorzugsweise für arbeitslose Lehrer geeignete – oder zumindest per Arbeitsamts-Umschulung eröffnete – Berufsstand im Gegensatz zum herkömmlichen Schützengraben-, Fließband- oder Kanzleitrottel gemeinhin genießt, speist sich aber sowieso nicht aus dem Nutzen, den die durchschnittliche Menschheit aus seinem Wirken ziehen könnte. Recht hoch angerechnet wird dem „EDV-Spezialisten“ vielmehr üblicherweise die „Intelligenz“, die sein Geschäft erfordere – womit ungeachtet des Inhalts seiner gedanklichen Anstrengungen gemeint ist, dass diese dem gebräuchlichen Alltagsverstand nicht unmittelbar nachvollziehbar sind.
Letzteres ist kein Wunder. Schließlich ist es seine Aufgabe, die der Maschine anzuvertrauenden Routineverrichtungen in einer Weise zu fassen, wie sie auch der dümmste Zeitgenosse nicht zu denken pflegt; in einer Weise, wie sie vielmehr der reinen Unintelligenz des elektrischen Automaten gerecht wird. Diesem geht ja ganz grundsätzlich ab, was noch jeder Verwaltungsgehilfe oder Mechaniker, mag ihm seine Tätigkeit auch als noch so „hirnlos“ vorkommen, ganz selbstverständlich betätigt: eine Vorstellung sowohl vom Inhalt, also der Verschiedenheit der ihm übergebenen „Daten“ und Aufgaben als auch von der Absicht seines Umgangs mit ihnen. Der Computer hingegen hat weder von der Bedeutung seines „Inputs“ den geringsten Dunst noch davon, worauf die von ihm zu leistende „Verarbeitung“ desselben hinauslaufen soll. Ihm würde es überhaupt nichts ausmachen, beispielsweise „Schweinfurt“ als einen Vornamen anzuerkennen oder auch zum Rechnungsbetrag zu addieren usw. – allemal handelt es sich bei seinem Material ja um Konfigurationen binärer Werte.
Dass der professionelle Idiotismus der Maschine ein zweckmäßiges Resultat hervorbringt, ist durch ein „Programm“ sicherzustellen. Der geistige Aufwand, den der Programmierer hier zu treiben hat, zeichnet sich zuallererst dadurch aus, dass er in umgekehrtem Verhältnis steht zu jeglicher Erkenntnis, die für dieses Geschäft benötigt oder aus ihm zu gewinnen wäre. Die zu automatisierende Verrichtung ist für die maschinelle Verarbeitung in Gestalt einer „Logik“ abzubilden, die ganz prinzipiell ohne jegliche Kenntnis von Zweck und Gegenstand dieser Tätigkeit auszukommen hat. Während man von den Anweisungen, die man dem lebendigen „Mitarbeiter“ gibt, so gerne sagt, man „erkläre“ diesem seine Aufgabe, ist ein Computerprogramm seiner Natur nach das Gegenteil jeglicher Erklärung. Die Vorstellung vom Zweck der Verarbeitungsleistung ist durch eine Abfolge primitiver Einzeloperationen ersetzt – auf die Daten zugreifen, sie mit anderen vergleichen, mit ihnen rechnen, sie irgendwo abspeichern usw. –; diesen sind die Daten in Form ganz äußerlicher Kennzeichnungen zugewiesen, insbesondere der Ort, wo sie vom Datenträger abzuholen sind. Schließlich ist auch noch umfängliche Sorge dafür zu leisten, dass der Computer auch zu verarbeiten aufhört, wenn dafür gar keine Daten mehr vorhanden sind – wann hat man ein solches Problem mit einer herkömmlichen Arbeitskraft schon gehabt?
Recht banale Vorgänge wie das Erstellen einer Bestandsliste erhalten da eine ziemlich komplizierte Gestalt, so dass man schon sagen kann, Programmieren sei ein geistiger Beruf. Will man angesichts der begriffslosen Sturheit des Geräts einen Überblick über den Effekt der selbstdefinierten Befehlsfolgen bewahren, muss man schließlich eine gehörige Portion geistiger Disziplin“ aufbringen, um dessen begriffslose Sturheit nachzuvollziehen. Zusätzlich ist bei der Abfassung der beabsichtigten Operationen genauestens auf die Einhaltung der mitunter recht vertrackten Konventionen zu achten, nach denen sich das Gerät dirigieren lässt, insbesondere der jeweiligen „Programmiersprache“. Der reine Formalismus, als der sich das Produkt solcher gedanklicher Anstrengungen schließlich nach außen hin darstellt, erweckt bei Außenstehenden sogar bisweilen den Eindruck, es handle sich hier um eine Kunst.
Solche Mystifizierung mag der Fachmann vielleicht für etwas naiv halten; unrecht ist sie ihm nicht. Auf jeden Fall zeigt sie ihm, dass die spezifische Borniertheit seines Berufs derzeit schwer gefragt ist, er sich auf sie also mit Fug und Recht etwas einbilden kann, ganz ohne dazu noch ein Ideal höherer Nützlichkeit namens „Berufsethos“ bemühen zu müssen. Nach langem Herumgebastel schließlich ein „ablauffähiges“ Produkt abliefern zu können – wozu auch immer dieses gut sein mag –, reicht ihm zu seiner Zufriedenheit, denn dann ist sein Auftrag- bzw. Arbeitgeber mit ihm zufrieden und er mit sich. Dass man ihn solche Programme machen lässt, betrachtet er nämlich als „Herausforderung an sein gedankliches Geschick. Und nicht selten ist ihm diese Umdeutung seines Dienstes in seine höchstpersönliche Fähigkeit und Neigung auch noch den praktischen Beweis wert, sich seinen eigenen PC ins Schlafzimmer zu stellen. Schließlich ist man ja nicht einfach ein nützlicher Fachidiot.
Beruf: Psychologe
Leute danach beurteilen, „was für Welche“ sie sind; Mitmenschen durch verständnisvolle Ratschläge dazu bringen, anders – besser, tüchtiger, glücklicher – zu werden: Diese beiden Beschäftigungen hat die moderne bürgerliche Gesellschaft zum Inhalt eines eigenen akademischen Berufes erhoben. Natürlich hören deswegen die nicht eigens ausgebildeten Zeitgenossen keineswegs damit auf, ihre Menschenkenntnis spielen zu lassen und ihre Umgebung mit besserwisserischem Rat zu behelligen. Solchem Dilettantismus tritt heutzutage aber der geschulte Profi zur Seite.
Der berufsmäßige Psychologe gibt sich nicht mit einer zusammenfassenden Einschätzung zufrieden, woran man bei einem Menschen ist, d.h. was dieser dem einen oder anderen Interesse an ihm, an seinen Kenntnissen, an seiner Zuverlässigkeit und anderen Tugenden, an seiner Ausdauer und anderen Tüchtigkeiten – zu bieten hat. Solche Beurteilungen sind allemal leicht als die Äußerungen eines befriedigten oder enttäuschten Interesses zu identifizieren, die mehr über den speziellen Nutzen verraten, den einer aus einer anderen Person ziehen will oder wollte, als über diese Person, ihre Beweggründe, Interessen und Urteile. Davon emanzipiert sich der psychologische Fachmann. Er wartet mit wissenschaftlich konstruierten Ermittlungsverfahren auf, die eine ganz objektive Bestandsaufnahme dessen versprechen, was „in“ einem Menschen „steckt“, noch ganz unabhängig von den inhaltlichen Anforderungen eines Berufs oder Studiums, eines Ehe- oder Familienlebens oder einer noch anders gearteten Karriere.
In psychologischen Tests werden diese Anforderungen simuliert; einerseits so genau wie möglich, andererseits unter sorgfältiger Vermeidung jedes Inhalts, um den es in Wirklichkeit geht, jedes materiellen Interesses, mit dem die Testperson zu tun bekommt oder bekommen soll, jeder Auseinandersetzung mit ihr über Dinge, die für sie eine Rolle spielen oder wichtig werden sollen. Der Psychologe ist ja nicht – und will auch gar nicht sein der Ehepartner, dem an der Zuneigung eines Menschen liegt, oder der Lehrer, der einem Schüler bestimmte Fertigkeiten oder Wissensbrocken vermitteln soll, oder der Arbeitgeber oder Personalchef, der irgendeine Arbeit mit geschäftsdienlicher Geschwindigkeit und Sorgfalt erledigt haben will. Einen anderen Standpunkt als den der Nutzbarmachung von Menschen kennt der Berufspsychologe aber auch nicht. Er tritt als Anwalt aller derartigen Anliegen auf, ohne sie zu teilen und sich mit der Person, die er beurteilen soll, über deren Erfüllung zu streiten. Seine Parteilichkeit für die wirklichen Anforderungen des bürgerlichen Daseins ans Individuum und für eine funktionsgerechte Bewährung in den verschiedenen Sphären der Konkurrenz ist abstrakt; sie gilt keiner realen Konkurrenznotwendigkeit, sondern der Idee des „Bewältigens“ und „Fertigwerdens“ schlechthin. Dabei ist seine Parteilichkeit für dieses Prinzip aber nur um so radikaler: Das Genügen oder Versagen einer Person vor seiner abstrakten Anspruchshaltung, in der alle bürgerlichen Zwänge aufgehoben sind, fasst der akademische Seelenkenner als Ausweis einer inneren Beschaffenheit des Subjekts auf, als Äußerung eines seelischen Wesens.
Die Urteile, nach denen einer sein Leben einrichtet, nimmt er von vornherein gar nicht als – richtige oder falsche, diskutable oder indiskutable – Urteile, sondern als Symptome einer dem Individuum angeblich zugehörigen, quasi eigenschaftlichen Fähigkeit, überhaupt Anforderungen von der Art zu entsprechen, wie Familie und Arbeitgeber, Lehrer oder Nachbarn sie an einen stellen. Am mehr oder weniger willigen Ehegatten überprüft der Psychologe in diesem Sinn die „Liebesfähigkeit“, am Schüler neben dem wirklichen Schul(miss)erfolg die größere oder geringere „Lernfähigkeit“, am Arbeitnehmer getrennt von der wirklich geschafften Karriere die „Fähigkeit“ zum Karrieremachen überhaupt usw. Diese gedachte seelische Eignung will er messen; und zwar objektiver und gründlicher, als das im praktischen Leben geschieht, wo die errungenen Erfolge und erlittenen Niederlagen ganz sachlich darüber entscheiden, was aus einem Menschen wird und „was für einer“ er am Ende ist. Der psychologische Test simuliert an bewusst unpraktischen Aufgaben praktische Siege und Misserfolge, um Material für den „Rückschluss“ auf eine dem Individuum angeblich innewohnende Erfolgstüchtigkeit und deren Maß beizuschaffen.
Es gehört durchaus Professionalität dazu, diesen Standpunkt durchzuhalten. Schließlich muss der Psychologe geduldig jeder Versuchung widerstehen, die Person, die er einschätzen soll, als urteilendes, eigene Interessen geltend machendes, falsch oder möglicherweise sogar richtig argumentierendes Subjekt zu nehmen, sich mit ihr über gewisse Einschätzungen zu streiten, sie zu widerlegen oder sich widerlegen zu lassen usw. Sein Job ist es, radikal ernst zu machen mit der Interpretation des ihm vorgeführten Menschenmaterials als „Fälle“, die mit allen ihren Äußerungen nichts als innere Dispositionen und Determinationen verraten. Es darf bei ihm nichts von Beschimpfung an sich haben, wenn er – eingedenk des an der Uni Gelernten – seine Klienten wie eine Art besonders komplexer und dressurfähiger Ratten auffasst, deren Verhaltensweisen als Reaktionen auf gegebene Reize zu erfassen, am Maßstab wohlberechneter Durchschnittswerte zu messen und als normentsprechend oder abweichend einzuordnen sind. Der Berufspsychologe muss als Urteilsinstanz auftreten, die mit den Leuten gar nicht auf gleichem Fuß steht und verkehrt, sondern prinzipiell und immerzu „dahinterblickt“; in die Welt der Zwänge und Anlagen nämlich, in der festgelegt sein soll, was einer überhaupt begreifen und wollen, leisten und an Bedürfnissen entwickeln kann.
Mit solchen Richtersprüchen über die Leistungsfähigkeit des Willens und Bewusstseins der Leute erfüllt der Psychologenstand seinen ersten Dienst für die moderne Gesellschaft: als Eignungstester für alle bürgerlichen Lebenslagen; Arbeitsämter und Personalbüros, Schulbehörden und der TÜV, Zeitschriften und soziale Vereine stellen dafür Posten und Etats bereit. Dieser Dienst besteht nicht in der wirklichen Ermittlung dessen, wozu ein Individuum überhaupt taugt; wer Menschen anwenden will, der verlässt sich im bürgerlichen Alltag ohnehin mehr auf den materialistischen Grundsatz, dass ein freies Subjekt sich noch allemal für das hergibt und das zustandebringt, wofür man ihm mit Erpressung und Geld einen guten Grund liefert. Der Beitrag der Psychologie bezieht sich auf die Ideologie der Konkurrenz: auf den bürgerlichen Aberglauben, die Welt des demokratischen Kapitalismus böte jedermann letztlich nichts als allenfalls etwas ungleich verteilte Chancen und Möglichkeiten, aus dem Eigene Leben zu machen, was einem jeden beliebt, gefällt und gelingt. Sie widmet sich dem zu dieser Lüge gehörigen Zirkelschluss von dem wozu es einer gebracht hat, auf dessen „Natur“ und Fähigkeit, aus sich „etwas zu machen“. Moderne Seelenkunde übersetzt, gelehrt und methodisch, die Ergebnisse der Benützung der Leute und ihres freiheitlichen Konkurrierens in die Vorstellung, da äußerte sich ein jedem einzelnen eingeschriebenes (Miss-)Erfolgsgeheimnis. Sie macht jedes Individuum mit seiner höchstpersönlichen „Ausstattung“ dafür verantwortlich, wie mit ihm verfahren wird und was deswegen aus ihm wird, und bescheinigt ihm zugleich mit der Idee einer naturwüchsigen Disposition seine prinzipielle Unzurechnungsfähigkeit. Das ist ihr eigentümlicher Zusatz, ihr wissenschaftliches Vor- und Nachwort zu der Sortierung, die der kapitalistische Alltag mit Schule, Berufshierarchie, Familienleben und Konkurrenz auf handfeste, gesetzlich geschützte Weise durchsetzt. Bei den Einstellungsbehörden von Staat und Wirtschaft, aber auch bei manchen besorgten Eltern und aufgeklärten Heiratsbewerbern ist dieser ideologische Zusatz sogar als praktischer Leitfaden zu Ehren gekommen: Sie richten sich in ihren Personalentscheidungen gern nach den Ergebnissen psychologischer Tests.
Verkehrt machen können die wissenschaftlich geschulten Praktiker dabei kaum etwas: Für die Ausscheidung überzähliger Kandidaten geben die Befunde aus den Psycho-Fragebögen und -Labors genauso gute Anhaltspunkte her wie jeder Würfel, und dabei genügen sie noch den höchsten Ansprüchen an die Gerechtigkeit und einen Schein von Objektivität. Außerdem reagieren die meisten Leute, moderne Konkurrenzgeier schon gleich, in der „unter Laborbedingungen“ simulierten Anforderungssituation trivialerweise so ähnlich wie in der wirklichen Lebenspraxis, von deren Inhalt der psychologische Test gerade kunstvoll absieht; das verstehen und verkaufen die Berufspsychologen als innerwissenschaftliche „Validierung“ und glanzvolle lebenspraktische Bestätigung ihrer Testerei. So konnte der Irrtum kaum ausbleiben, dass etwas daran sein muss, wenn ein ganzer staatlich anerkannter Gelehrtenstand professionell ein solches Einschätzen von Leuten betreibt.
In den fortschrittlichsten Demokratien ist diese Sichtweise auch beim breiten Publikum bestens angekommen. Der Standpunkt, dass Wille und Verstand der Menschen unter dem Gesichtspunkt ihrer Benutzbarkeit gemessen gehören und dabei ihre spezielle innere Determination zu erkennen geben, gibt offenbar eine unschlagbare Konkurrenzideologie her. Er hat jedenfalls längst die unprofessionellen Manieren der Menschenkenntnis und Selbsteinschätzung erobert und ganz neue Bedürfnisse nach Rat und Hilfe zur „Lebensbewältigung“ hervorgebracht, die wiederum der Berufsstand der Psychologen beflissen bedient.
Was moderne Menschen tun müssen – als Mieter oder als Hausfrau, als Mitglied einer konkurrierenden „Betriebsfamilie“ und als abwägender Konsument mit oder ohne Kredit, als politisierender Wähler oder als Eltern schulpflichtiger Kinder – und was sie deswegen (dann bloß noch) sind, das beurteilen auch ungeschulte Menschenkenner heute ganz ohne jedes objektive Urteil über die gesellschaftlichen Sachverhalte, an denen die Leute sich zu schaffen machen müssen und denen sie ihr Dasein und Sosein verdanken. Geprüft wird die Art und Weise, die einer bei der „Bewältigung“ seines Lebens, dessen paar Inhalte längst festliegen, an den Tag legt darin wird nach einer Tauglichkeit eigener Art gefahndet. Den Maßstab gibt das dumme Ideal vom „gelungenen Leben ab: einer Lebensführung, die ganz jenseits aller Inhalte des geführten Lebens, sogar unabhängig von den Bedürfnissen des Individuums und deren Befriedigung oder Versagung, das Subjekt mit sich selbst zufrieden sein lässt. Daran soll sich nämlich entscheiden, ob und inwieweit es einem gelungen sei, sein „Selbst“ zu „verwirklichen – so als wäre die gesellschaftliche Welt mit ihrem Zwang zum Geldverdienen und ihren erpresserischen Notwendigkeiten und Gesetzen ein einziger Freiraum dafür, dass die Leute ihre Dispositionen und inneren „Zwänge“ „ausleben“ oder auch nicht, einem ihnen eingeschriebenen Erfolgsgesetz folgen oder eben ihr „Selbst“ verfehlen; und so als wäre das Inhaltsleerste die pure Form der Reflexion, das „Selbst“ eben, der Inbegriff aller zulässigen Wünsche, Einsichten und Bedürfnisse eines Menschen.
Von den Berufspsychologen haben moderne Menschen den Fehler gelernt, in sämtlichen Betätigungen, und ausgerechnet in den intimsten am hartnäckigsten, aus jedem Erfolg und Misserfolg einen „Schluss“ auf die eigene Person und deren vorgegebene „Ausstattung“ zu ziehen. Sie haben gelernt, jeden Treffer als Verweis auf eine höchstpersönliche Erfolgstüchtigkeit, jeden Missgriff als Offenbarung einer determinierenden Unfähigkeit zu verstehen: Angeberei bzw. Betrübte Selbstbetrachtung mit Methode. Die Moralität moderner demokratischer Gesellschaften ergeht sich nicht mehr in der Dialektik von Gesetz, Schuld und Sühne, sondern hat die rauhen Sitten des rechtsstaatlichen Konkurrierens zu der Vorschrift veredelt, „sich selbst“ zu entsprechen. Sie führt Missgeschick und Unzufriedenheit auf eine Verletzung dieses individuellen Lebensgesetzes zurück und verlangt von jedermann, ungeachtet seiner „äußeren Umstände“ mit sich selbst „ins Reine“ zu kommen. Auch das haben aufgeklärte Zeitgenossen sich beibringen lassen, ihre Launen furchtbar wichtig zu nehmen und aufmerksam in ihr dürftiges Gefühlsleben hineinzuhorchen, um den dort angetroffenen unwillkürlichen Regungen eine Auskunft über die Natur und die verborgenen Wünsche und Leiden ihres „Selbst“ abzulauschen. Je mehr „Probleme“ ein moderner Mensch hat, um so weniger befasst er sich mit diesen und den Sachen, die ihm Schwierigkeiten machen; um so hartnäckiger bemüht er sich um ein möglichst tiefsinniges Bild von der Eigene persönlichen „Prägung“, den Gaben und Schranken seines Seelchens und um dessen pflegliche Behandlung.
Auf diese Moralität sind die Profis der modernen Seelsorge mit ihrem Angebot an Rat und Hilfe eingestiegen; und es ist ein Bombenerfolg daraus geworden. Massen frei praktizierender Psychologen sowie die Angestellten gesellschaftlicher Seelenbetreuungsunternehmen warten mit unerschöpflichen Vorräten an Verständnis auf für jeden, der sich mit seinen Problemen und Misserfolgen auf den psychologischen Fehler festgelegt hat, sich selbst eines seelischen Gebrechens zu bezichtigen und in Betrachtungen seiner naturwüchsigen Unfähigkeiten Trost zu suchen. Der Psychologe gibt diesen Reflexionen erstens recht, und das zweitens viel mehr und ganz anders, als „der Fall“ es sich hat einfallen lassen. Wo immer der ratsuchende Kunde noch ein Urteil über seine „Umgebung“ – seinen Beruf, seine Kollegen, seine Familie usw. – fällt, da hält der Profi ihn dazu an, sich selbst ins Auge zu fassen, die das Urteil begleitenden Empfindungen zu registrieren und sich an die Vorstellung zu gewöhnen, darin würden sich überhaupt erst die wahren und eigentlichen Ursachen seiner Urteile und seiner Stellung zur Welt überhaupt verraten. Damit beginnt die psychologische Verführung zur Konstruktion eines anschaulichen Bildes vom Eigene unwillkürlichen „Selbst“. Mit der Autorität des Fachmanns bläst der akademische Ratgeber seinem „Fall“ die Vorstellung von Kräften, Energien, Potenzen und dergleichen ein, die im – jenseits wacher Selbstkontrolle beheimateten – seelischen „Innern“ des Individuums ihren Tanz aufführen und den Verstand und Willen, den einer aufbringt, in Wahrheit herumstubsen. Die „selbstkritische Einsicht“, zu der der Fachpsychologe seinen Klienten bringen will, besteht eben darin, ihn so in die Phantasiewelt eines inneren Dramas zu verstricken, bis er daran glaubt, sie zu seinen ganz selbstverständlichen Erfahrungen rechnet und sein Tun und Lassen als Äußerung jenes fiktiven Inneren nicht bloß ansieht, sondern methodisch handhabt. Die Schwindeleien des Therapeuten müssen zum Selbstbetrug des „Patienten“ werden. Wird der Seelendoktor sich mit seinem „Fall“ auch noch darüber handelseinig, dass ein paar neue Launen, unterbliebene Schweißausbrüche oder sonstige „Erfolgserlebnisse“ einen Wandel der fiktiven inneren Dramaturgie vermuten lassen, dann lässt der Kunde womöglich von ein paar lästigen Marotten ab, die er bis dahin als Inbegriff einer ihn beherrschenden Unfähigkeit, als sein „Leiden“ gepflegt hatte; und der Berufspsychologe verbucht wieder einen therapeutischen Erfolg.
Bis dahin kann es bei zahlungsfähiger Kundschaft schon mal Jahre dauern. Geschickte Psychoanalytiker lassen ihre „interessanten Fälle“ nicht davonkommen ohne die umfassende Neukonstruktion einer kompletten innerseelischen Lebensgeschichte, bei der Träume und Kindheitserinnerungen der methodisch eingestellten Einbildungskraft des Klienten immer neue Nahrung geben – und dem Therapeuten das Material für immer neue Vexierbilder vom angeblich eigentlichen „Selbst“ des Kunden liefern. Wo die AOK die Spesen trägt und auf kostengünstige „Heilungs“-Erfolge drängt, kommen Fachpsychologen aber geradesogut mit einem Minimum an „Einsicht“ bei ihren Patienten zurecht. So roh wie der Spleen, den sich da einer abgewöhnen soll, sind die mit Pillen unterstützten Überzeugungskünste der Profis von der „systematischen Desensibilisierung“. Ansonsten bescheren Gesprächstherapeuten in wachsender Zahl einer wachsenden Kundschaft wöchentlich ein paar schöne Stunden, in denen beide Seiten sich zwanglos darüber einigen, wie prächtig der Fachmann sich doch auf den von sonst niemandem (an)erkannten verborgenen inneren Reichtum der problembeladenen Individualität des leidenden „Falles“ versteht.
So betreuen die berufsmäßigen Psychologen die Lüge von der „Selbstverwirklichung“, die den blessierten Mitmachern des Kapitalismus vorgaukelt, in der modernen Welt könnte man gar keine anderen Probleme haben als solche mit sich. Sie benutzen die Freiheit, die im Reich der Einbildung herrscht, für die Einbildung innerlicher Zwänge nebst Befreiung davon. So helfen sie den Leuten dabei, sich zu Charaktermasken der demokratischen „Marktwirtschaft“ zu vervollkommnen.
Beruf: Rechtsanwalt
Dass jemand aus Gewalt sein Geschäft macht, traut man in unserem gesitteten Gemeinwesen nur Verbrechern zu; in Demokratien mit etwas lockereren Sitten allenfalls auch den privaten Verbrechensbekämpfern. Dabei wäre die bürgerliche Gesellschaft ganz und gar funktionsunfähig, wenn professionell bewerkstelligte Gewalt bloß als das Metier einer Handvoll Schlägertypen vorkäme.
Eine ganze Armee studierter Ehrenmänner und -frauen sorgt für die Allgegenwart von Gewalt, der öffentlichen nämlich, in sämtlichen gesellschaftlichen Verhältnissen.
Sogar den allerprivatesten. Sobald Familien sich auseinandersortieren wollen, erläutert ein Rechtsbeistand dem „Intimpartner“, den er betreuen darf, die Zwangsmaßnahmen, die der staatliche Schutz von Ehe und Familie ihm gegen den anderen und dem andern gegen ihn an die Hand gibt, und setzt das passende Verfahren in Gang. Gewiss, sich streiten, einander ärgern, „sich auseinanderleben“ und verprügeln, das können Ehepaare allein; und für die Abhängigkeit voneinander, in die sie sich hineingeritten haben, ebenso wie für das Anspruchswesen, in das ihre Liebe nur allzu leicht und schnell ausartet, genügt die öffentliche Gewalt mit ihren entsprechenden Vorschriften und das allgemeine Bewusstsein, dass der Mensch sich auch in seinem Liebesleben danach und nicht nach seinen Gefühlen und Lagebeurteilungen zu richten hat – der andere Mensch jedenfalls. Erst der Anwalt erschließt dem beleidigten Rechtssubjekt aber das auf seinen Fall passende Repertoire von Handhaben, denen der Rechtsstaat seine Gewalt leiht; Handhaben, um auf Kosten des Verflossenen bleibende Vorteile aus der Vergangenheit herauszuholen und gleich auch noch ein bisschen Rache zu üben. Er macht den Führer durch all die zur Inanspruchnahme staatlichen Zwangs befugten Ansprüche gegeneinander, die überhaupt erst aufkommen, wenn das Interesse aneinander erloschen ist. Er bringt die Auseinandersetzung in Schwung, indem er dem Ehepartner die Rechtslage als die höhere, wirksamere Form seiner Interessen verdolmetscht, umgekehrt jedem Zerwürfnis die Chance zu einer gerichtlichen „Klärung“ entnimmt. So leistet er dem moralisch empörten Ehegatten Scharfmacherdienste und sorgt dafür, dass die unendlich überlegene Zwangsgewalt des staatlichen Justizapparats gemäß ihren Eheschutzvorschriften an die Stelle der privaten Gehässigkeit tritt, die Privatleute einander sonst allenfalls antun können.
Wo es nicht um Liebe, sondern gleich ums Geschäft geht, sind die Rechtsanwälte von vornherein mit dabei, sobald ein Geschäftspartner sich ihren Beistand leisten kann. Sie feilen an den Geschäftsbedingungen und Vertragstexten mit dem einzigen Ziel, dass sie den so gut beratenen Vertragspartner möglichst zu nichts, den Kontrahenten zu so viel wie möglich verpflichten. Das Geschäftsinteresse ihres Auftraggebers – an Miete oder Warenlieferung, Kreditbedienung oder Arbeitsleistung … – müssen sie dafür nur unter dem einen Gesichtspunkt kennen und in Betracht ziehen: Es ist dem der anderen Vertragspartei überhaupt nicht wohlgesonnen – umgekehrt ebenso wenig –; es gibt keinen Inhalt, der die Übereinstimmung der geltend gemachten Interessen mit sich bringt und so gewährleistet; selbst in ihrer Übereinkunft bleiben sie einander entgegengesetzt, schließt also der Nutzen des einen einen Nachteil des andern ein – und umgekehrt –; zu vertraglicher Einigkeit kommt es nur aufgrund wechselseitiger Abhängigkeit bei fortdauernder Gegensätzlichkeit; mit dem Vertrag unterwerfen die Partner sich also einem Zwang, den jeder gleichzeitig für sich gegen den andern auszunutzen sucht. Dieser widersprüchliche Zirkus, dem Rechtsanwälte dienen, ist kein Sonderfall, sondern die Normalform aller im bürgerlichen Gemeinwesen üblichen Geschäftsbeziehungen. Sie alle schließen Feindseligkeit der übereinkommenden Interessen ein, können deswegen ihre Übereinkunft ohne übergeordnete Gewalt überhaupt nicht verläßlich festhalten, brauchen also Betreuung durch staatlichen Zwang. Daran hat die bürgerliche Obrigkeit es nicht fehlen lassen. Unter tatkräftiger Mithilfe des Anwaltsstandes hat sie ein Vertragsrecht geschaffen, das längst jede Lebenslage erfasst und für jede Tücke und Finte Handhaben wie Abwehrmittel bereitstellt. Den Überblick darüber zu behalten, fordert einen professionellen Fachidioten; als solcher dient sich der Rechtsanwalt den Geschäftemachern an.
So richtig zum Zuge kommt dieser Dienst natürlich dann, wenn es tatsächlich zum Streitfall kommt – was selten der Fall ist, ohne dass der Anwalt den guten Rat erteilt hat, es dazu kommen zu lassen. Sein Engagement steigt mit dem Streitwert, denn danach richtet sich die Vergütung des rechtlichen Beistands. Diese Regelung ist erstens gerecht: Wenn der Anwalt sich sowieso als Agent und Nutznießer der Interessengegensätze fremder Leute durchs Leben schlägt, dann ist die Größe der strittigen Interessen auch das passende Maß seines Einkommens. Zweitens hat das den praktischen Nebeneffekt, der staatlichen Justiz die Befassung mit den finanziell geringfügigen massenhaften Streitigkeiten der „kleinen Leute weitgehend vom Hals zu halten, die denen zwar furchtbar am Herzen liegen, aber kaum je einen Anwalt bezahlt machen. Zwar gehen in einer Gesellschaft von Rechthabern kaum noch Blechschäden am Auto über die Bühne, ohne dass zwei Anwälte daran verdienen; aber da zahlt ja auch die Versicherung des unterlegenen Prozesshansl. Was die andere Seite des Geschäfts, die großen, lohnenden zivilrechtlichen Auseinandersetzungen betrifft, so muss der nationale Berufsstand neidvoll eingestehen, dass das angelsächsische Rechtssystem mehr Freiheiten bietet als das deutsche, das Vertragsrecht als Waffe bis zur Vernichtung eines Geschäftspartners und für den edlen Zweck massiver Bereicherung einzusetzen, also auch als Anwalt stinkreich zu werden. Der deutsche Rechtsvertreter muss sich da mehr mit dem moralisch erhebenden Bewusstsein trösten, in seinem Dienst an gewalttätigen Privatinteressen nicht bloß der Anwalt seines Auftraggebers, sondern zugleich der beflissene Lakai des übergeordneten Ordnungsgesichtspunkts zu sein, nach dem er dessen Interessen durchzusetzen sucht: des staatlichen Rechts, das nach gar nicht privaten Gesetzen die Segnungen seiner Zwangsgewalt verteilt.
Dabei hätten die Rechtsanwälte nur halb so viel zu tun und zu verdienen, würden sie nicht ihrer zahlungsfähigen Kundschaft vor allem auch gegen den Staat und dessen gesetzmäßige Ansprüche beistehen. Als geistige Leistung genommen, treibt der Anwalt hier sein Spiel mit der logischen Differenz zwischen der Allgemeinheit der Gesetze, in denen vom Staat Ansprüche gegen den Bürger erhoben werden, und der Besonderheit des Einzelfalls, dessen Subsumierbarkeit unter die allgemeine Regel der Anwalt bestreitet. Praktisch befasst er sich mit dem Widerspruch, dass jeder Geschäftsmann seine Verpflichtungen dem Staat gegenüber und auch seinen Gehorsam gegen die Gesetze als Aufwand betrachtet, für den er einen ihm speziell zugute kommenden Ertrag sehen will, während der Staat seine Dienste für prinzipiell und prinzipiell unbezahlbar hält und selbst mit seinen betuchtesten Untertanen keine Geschäfte tätigen will, was deren gesetzliche Pflichten betrifft. Dieser Widerspruch eröffnet ein weites Feld von Auswegen, Kompromissen und Ausnahmen, die mal den Geist, mal den Buchstaben des Gesetzes strapazieren; manchmal die Regel bestätigen, indem sie ihr nicht gehorchen – ein Paradies für Rechtsexperten. Auch bei Bestechungen größeren Zuschnitts werden als Unter- und Zwischenhändler Rechtsanwälte eingeschaltet, die sich auf die Herstellung des nötigen Scheins von Legalität verstehen. Das Gesetz ist Dogma, Metier und Geschäftsgrundlage des Rechtsanwalts; aber Parteilichkeit für bestimmte materielle Staatsinteressen wäre der Ruin seines Geschäfts.
Dasselbe gilt in der Sphäre, die zwar nicht die gesellschaftliche Nützlichkeit, aber – ausgerechnet – die Berühmtheit des Berufsstandes begründet: der Strafjustiz. Als Verteidiger hat der Anwalt sowohl die belastenden Fakten als auch deren Subsumtion unter strafrechtliche Paragraphen anzuzweifeln und mit Gegenkonstruktionen aufzuwarten. Sein Image schwankt dementsprechend zwischen dem eines Parteigängers von Verbrechern und dem des Retters der verfolgten Unschuld. Während er letzteres genießt, verwahrt er sich gegen Vorwürfe der ersten Art mit dem Verweis auf seine Unentbehrlichkeit als Organ der Rechtspflege: als Anwalt der Gerechtigkeit ohne Ansehen der Person. Dieses Ethos, für dessen Glaubwürdigkeit ein ganzer Apparat zur freiwilligen Selbstkontrolle des Berufsstandes, die Anwaltskammer, eintritt, kann man zwar unbesehen als Heuchelei abbuchen; objektiv ist an dieser Zweckbestimmung aber mehr dran, als Rechtsanwälte selber wissen und meinen. In der gesamten Veranstaltung namens Strafjustiz geht es nämlich von vorn bis hinten um gar nichts anderes als darum, dass das Gesetz seine unversehrte Hoheit beweist: seine souveräne Gültigkeit, auch wenn es noch so oft gebrochen wird. Wäre es zum Verhindern der verbotenen Untaten da, so hätte es längst seinen totalen Bankrott anmelden können. Es ist aber ein Verbot, und als solches rechnet es fest damit, dass das Kriminelle dauernd passiert: Es definiert ja eine gesellschaftliche Praxis als Verbrechen. Die Gültigkeit des Gesetzes hängt folglich an der Glaubwürdigkeit seiner Strafandrohung. Es kommt alles darauf an, dass das Gesetz als die „eigentliche“ Ordnungskraft gegen den Verbrecher recht behält. Zu diesem Zweck bestätigt es sich mit einer souveränen Gewalttat gegen den Delinquenten als fraglos überlegener, hoheitlicher, unbedingt verpflichtender Wille. Zu diesem Akt, mit dem das Gesetz sich per Bestrafung das Seine holt, gehört aber auch der Schein, dass dem Straftäter wirklich nichts als Recht geschieht. Dieser Schein existiert leibhaftig im Verteidiger, den im Notfall das Gericht selbst bestellt. Und auf diese Leibhaftigkeit, ordentlich eingekleidet, kommt es an – ob die Verteidigung dem Angeklagten nützt, ob der Anwalt überhaupt durchblickt, ist für diesen Erfolg ganz unwesentlich.
Den berufsmäßigen Durchblick besitzt der Rechtsanwalt ohnehin als unveräußerliches Merkmal in Form einer ständig aktualisierten Sammlung von Gesetzen und Fallentscheidungen sowie eines Gedächtnisses, das es ihm erlaubt, dieselben bei jedem neuen Fall an der passenden Stelle aufzuschlagen. Die Verstandesleistung, die dafür erforderlich ist, hat mit wissenschaftlicher Erkenntnis insofern zu tun, als sie das Gegenteil davon ist. Eine Tat oder Absicht wird da mit allgemeinen Bestimmungen verglichen, die nicht theoretischer Natur, also nicht aus der Analyse der jeweils verfolgten Zwecke gewonnen sind, sondern die das staatliche Interesse an dem Geschehen, die Intervention der Staatsgewalt ins Wollen und Handeln ihrer Untertanen, zum Ausdruck bringen. Das Ergebnis solcher Vergleiche sind allemal, logisch gesehen, Verfremdungen der Fakten, eben durch das eigentümliche „Licht“ rechtlicher Vorschriften. Dass die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften heute ähnlich verfahren – mit selbstgeschaffenen Sinnprinzipien statt Gesetzestexten als theoretischen Erleuchtungskörpern –, ist nicht Schuld oder Verdienst der Juristerei, sichert ihr aber die ehrenvolle Aufnahme im Reich des Theorietreibens. Kein Akademiker findet etwas dabei, das Nachblättern und Subsumieren unter staatliche Machtworte „Rechtswissenschaft“ zu nennen.
Das Studium vermittelt denn auch, neben der Kenntnis der dicken roten Kladden und ihrer Inhaltsverzeichnisse, die Gewohnheit, alles Nachdenken über den Lauf der Welt und ihrer großen und kleinen Affären auf die juristische Subsumtionskunst zu dressieren und diese für eine ehrenwerte Art des Nachdenkens zu halten. Für Gesinnungsfestigkeit möchte der Staat anschließend durch ein bisschen schlechtbezahlten Staatsdienst sorgen, ohne den die Karriere nicht losgehen darf.
Was dann ein Rechtsanwalt aus seinem guten Gedächtnis, seiner noch besseren Moral und seinen schlechten Denkgewohnheiten macht – an Geld und Laufbahn mit oder ohne eigene Kanzlei –, das ist im Wesentlichen eine Frage von Charakter und Beziehungen. Davon hängt es nämlich ab, wieviele potente Auftraggeber und lohnende Kunden einer davon überzeugt, ihre Rechtsangelegenheiten wären ausgerechnet bei ihm in den besten Händen. Demonstrative Selbstsicherheit; die Angeberei, durch nichts zu erschüttern und mit allen Wassern gewaschen zu sein; die glaubwürdige Vorführung einer Gerissenheit, die eine erfolgreiche Karriere als Trickbetrüger garantiert hätte, wenn ihre gesetzestreue Anwendung nicht lohnender erschienen wäre: Das gehört auf alle Fälle als menschliche Mindestausstattung zum guten Anwalt. In Vorlesungen lässt sich das nicht lernen; eher schon in Studentenverbindungen, „schlagenden“ am besten – und so richtig dann in der Praxis. Hat einer da Erfolg, kann die Qualität gar nicht ausbleiben. Umgekehrt umgekehrt – das ist das Berufsrisiko.
Beruf: Sozialarbeiter
Hilfreich und mildtätig sein, Ratschläge verteilen, fremde Leute bevormunden – und davon auch noch leben können, nicht gerade fürstlich, aber immerhin wie ein Volksschullehrer: Das ist doch mal ein schöner Job für engagierte, gute Menschen. Für gute Menschen jedenfalls, die schon ihre Gründe haben werden, weshalb sie nicht gleich Pfarrer oder freischaffender Psychologe werden wollen; die mit einem bloßen Bürokratenposten aber auch nicht zufrieden sind.
Auf einem solchen landen sie zu guter Letzt zwar meistens. Denn ihr Beruf ist nun einmal in der Welt der Ämter und Behörden angesiedelt. Als Sozialarbeiter sind sie aber eindeutig keine Verwaltungshengste oder Hinterzimmerdamen, sondern ein personifiziertes quasi-, halb- oder ganzstaatliches Hilfsangebot an die „sozial schwachen“ Problemkinder der Nation.
Dieses Angebot hat die Eigentümlichkeit an sich, dass seine Nutznießer, die Klienten organisierter Sozialarbeit, es gar nicht bestellt haben. Zwar herrscht an Notlagen kein Mangel in „unserer Überflussgesellschaft“. Die davon Betroffenen haben aber noch nie ein Gesuch um amtliche Betreuung an die Obrigkeit gerichtet.Sie haben in der Regel einen recht eindimensionalen Begriff von der Ursache ihrer Lage – dessen Richtigkeit kaum zu bestreiten ist: zu wenig Zaster! An diesem Übel leiden „Obdachlose“ und professionelle Stadtstreicher ebenso wie Eltern, die ihren Kindern weder Gemütlichkeit noch Taschengeld, sondern bloß „Verwahrlosung“ verabreichen, oder Ehemänner, die ihrer Gattin nichts als ungemütliche Ansprüche zu bieten haben und sich die entsprechende Abfuhr bieten lassen müssen – und umgekehrt. Klar, auch „Sozialfälle“ sind heutzutage gebildet genug, dass sie nicht nur ans Geld denken, sondern ihre Lebenslage dem nächsten erreichbaren Nächsten übelnehmen – der davongelaufenen Frau also oder den ungeratenen Kindern bzw. dem unausstehlichen Papa und trunksüchtigen Ehemann. Aber selbst das gibt keinen Übergang her zu dem Wunsch nach fachhochschulmäßig ausgebildeten Betreuern.
Deren Job verdankt sich einer sozialstaatlichen Definition gewisser ungemütlicher Lebensumstände als Zustand der Hilfsbedürftigkeit; und diese staatliche Definition hat ihre eigene, eben sozialstaatliche Logik. Das Elend langfristig Arbeitsloser und alter Frauen mit Minimalrente, die mehr oder weniger lautstarke bis gewalttätige Unzufriedenheit von Jugendlichen mit schlechtem oder ohne Job, die aussichtslose Lage Strafentlassener, gewohnheitsmäßiger Suff und ruiniertes Familienleben und manches mehr, was eine ordentliche Gesellschaft an ihren Mitgliedern nicht leiden kann, wird da unter einer Bestimmung zusammengefasst, die, theoretisch genommen, also als Erklärung der jeweiligen „Lebensweise“ schon mehr als fragwürdig wäre: Unfähigkeit, ohne Hilfestellung durch andere mit dem eigenen Dasein und dessen „Problemen“ zurechtzukommen, soll da jedesmal vorliegen.
In dieser Betrachtungsweise und Behandlungsart gilt das Leben in der Klassengesellschaft – einschließlich aller Probleme, die der friedliche Alltag bereithält, sowie sämtlicher Zerstörungen, die er an Sinn und Verstand der Leute hinterlässt – als Bewährungsprobe, die der Mensch im Durchschnitt besteht; so nämlich, dass er sich nützlich und nicht störend bemerkbar macht. Damit ist der Maßstab dafür gesetzt, was alles – bis hin zum Hungern und Frieren an der falschen Stelle – negativ auffällig wird und inwiefern: als ein Versagen des Individuums. Dieses fällt der Gesellschaft zur Last, „weil“ es alleine nicht gehörig klarkommt: Mit dieser Lüge werden Leute zu Sozialfällen zurechtdefiniert. An denen hat der Sozialarbeiter seine Aufgabe.
Diese besteht zuerst einmal in einer moralischen Offensive auf die zur Bearbeitung angewiesenen Fälle. Die Parole heißt: „Vertrauen gewinnen!“ und verrät schon einiges über die Widersprüchlichkeit einer „Hilfe“ ohne Hilfeersuchen des Adressaten, ja ohne dass dieser sich meist selbst im Sinne seiner offiziellen Definition als Versager versteht, dem ausgerechnet auch noch ein kleiner Staatsagent verständnisvoll unter die Arme greifen und ins Privatleben reinpfuschen müsste. Da wird eben nicht einfach ein Almosen überreicht, das mit einem gerührten oder geheuchelten „Danke!“ abgegolten wäre. Wo der Sozialarbeiter aufkreuzt, da bekommt es der besuchte Sozialfall mit dem Anspruch zu tun, sich und seine gesamte bisher praktizierte Lebensmoral beurteilen zu lassen und diesem fremden Urteil auch zu fügen; denn schließlich sind es ja nicht nur seine tatsächlichen Lebensbedingungen, die ihn zum Sozialfall stempeln, sondern die Gewohnheiten des Umgangs damit – aus denen soll ihm auf staatlichen Beschluss hin heraus-„geholfen“ werden. Sogar die verwahrlosende Oma erkennt im Besuch ihres Betreuers, bei allem Genuss des einkassierten Mitleids, den offenen oder unterschwelligen Tadel an ihrer – gar nicht unbegründeten – Auffassung, dass ein properes Erscheinungsbild sich für sie viel weniger lohne als die heimlichen Vergnügungen, die sie sich stattdessen gönnt. Zu dem Verhältnis muss der Sozialarbeiter es also zuallererst einmal bringen, dass seine Klienten sich überhaupt von ihm behelligen lassen und sich zu der Heuchelei herbeilassen, auf seinen Besuch und guten Rat hätten sie gerade noch gewartet.
Für dieses harte Geschäft der Vertrauenswerbung hilft es dem Sozialarbeiter nichts, dass irgendwo ja schon die Autorität des Sozialstaats hinter ihm steht und droht; im Gegenteil. Nur allzu leicht versteht – oder durchschaut? – der Klient den Moralismus, der ihm da als staatliches Angebot entgegentritt, als Vorboten genau der sozial- oder rechtsstaatlichen Gewalt, mit der er überhaupt keine hilfreichen Zusammenkünfte gehabt hat – sonst hätte er es ja gar nicht erst bis zum Sozialfall gebracht –, und begegnet ihm mit Misstrauen und Ablehnung. Andererseits ist der Sozialarbeiter eben doch kein Polizist und noch nicht einmal so direkt eine Genehmigungsbehörde für Sozialhilfen der materiellen Art, der die Kundschaft sich fügen muss, ob sie will oder nicht. Er ist ein gewaltloser Animateur zu durchschnittlicher Sittlichkeit und erfolgreichem Benehmen; und als solchem kann ihm der Verdacht seiner Klientel nicht egal sein. Er muss ihn ausräumen, gerade weil der Vorbehalt, auf den er stößt, beides ist: ungerecht, weil Sozialarbeiter gar keine Gerichtsvollzieher sind, und sehr richtig, weil ja tatsächlich die Staatsgewalt Sozialarbeiter als Frontkämpfer ihres weitherzigen Moralismus der normalen Bewährung in Marsch setzt, nachdem sie für missliche Lebenslagen gesorgt und die Definition der Betroffenen als reichlich hilfloser Kreaturen festgesetzt hat.
Also umfasst das Berufsbild des Sozialarbeiters an vorderster Stelle sämtliche Kniffe und Techniken der Anbiederei, und zwar derjenigen von oben nach unten. Weil der Sozialarbeiter als Staatsagent aufkreuzt, muss er seinen offiziellen Auftrag dementieren und glaubwürdig so tun, als hätte er aus innerstem Antrieb eben mal vorbeigeschaut. Weil er als Moralapostel den Mund auftut, muss er Amoralismus demonstrieren und vorheucheln, er selbst hätte die Untiefen des Menschlich-Allzumenschlichen locker hinter sich gebracht und stünde ihnen viel unvoreingenommener gegenüber als sein Auftraggeber. Weil er den Leuten sittliche Vorschriften machen soll, muss er sie von der Lüge überzeugen, er wäre eigentlich nur zum Zuhören gekommen, und uneingeschränktes „menschliches Verständnis“ vorzeigen. Kurzum: Weil sein Hilfsauftrag eine einzige moralische Zumutung ist, muss er ihn erfolgreich verleugnen – er muss sich mit aller Macht auf den Standpunkt seiner Klienten stellen, eben weil er selber alles andere als ein Sozialfall ist und ihren Standpunkt „zu ihrem eigenen Besten“ zurechtrücken will.
Das Ganze ist, wie sollte es anders sein, von vorn bis hinten eine peinliche Veranstaltung; nicht bloß, wenn es dem Sozialarbeiter selber zu dumm wird, weil ein paar besonders hartgesottene Sozialfälle ihn kalt abfahren lassen, sondern noch mehr, wenn er sich mit Lederjacke und lockeren Sprüchen „durchsetzt“ und den Ruf eines „duften Kumpels“ erobert oder wenn ein paar armselige Schafe dankbar ihr berechnendes Vertrauen auf ihn häufen.
Diese Peinlichkeit hat jedoch ihren guten Sinn: Zum einen stellt sie den Knackpunkt für die berufliche Eignung des Sozialarbeiters dar. Die joviale Tour – sei es mehr rockig oder mehr Hänschen-Rosenthal-mäßig – muss dem berufsmäßigen Freund und Helfer so zur Natur werden, dass er ihre Peinlichkeit gar nicht mehr merkt, sondern seine Umgebung mit seinem sicheren Selbstbewusstsein voll überfährt. Diesem edlen Ziel dient ganz zweckmäßig auch die fachhochschulische Ausbildung, die der Sozialstaat eingerichtet hat, damit er die Bewerber um Dienststellen gleich sortiert bekommt: Neben praktischen Übungen versieht das Studium den Nachwuchs an guten Menschen mit wissenschaftlichen Ideologien, die dazu angetan sind, das Bewusstsein von der heuchlerischen Natur des eigenen Treibens zu trüben, und die der erforderlichen Selbstsicherheit das gute Gewissen und den Schwung eines gelehrten „backgrounds“ mit auf den Weg geben. Ausbildung hilft Eindruck machen! Und darin liegt andererseits auch schon der Knackpunkt für den Erfolg sozialarbeiterischer Tätigkeit. Die will nämlich auf gar nichts weiter hinaus als auf die Vertrauenswerbung, mit der sie anfängt; nach der entsprechenden Eröffnungsoffensive kommt gar nichts Wichtiges mehr nach bzw. nur immerzu dasselbe wieder. Und die Betreuung ist gelungen, sobald der professionelle Betreuer von sich den Eindruck hat, dass er mal wieder unwiderstehlich war.
Gewiss, Sozialarbeiter bringen allerhand „konkrete“ Ratschläge zur gelungenen Lebensgestaltung an den Mann, die Frau oder das Kind, wenn sie den versoffenen Papa, die selbstmörderische Mutti oder den kleinen Schulversager erst einmal dazu gebracht haben, ihnen ein bisschen zuzuhören. Sie organisieren allerlei: Jugendtreffs und locker-gesittete Disco-Abende, Hausaufgabenhilfe und „Werkwochen“. Der Erfolg, der ihnen beschieden ist und den sie mit solchen Betreuungsmaßnahmen auch wirklich anstreben, fällt aber schon so ziemlich damit zusammen, dass sie ihre Klienten zur Teilnahme animiert haben. Das ist nämlich ihr Beweis, dass sie das Vertrauen der ihnen Anvertrauten haben gewinnen können und dass die sich nicht mehr einfach „gehen lassen“ wollen. Das ändert zwar sonst nichts; und der gute Wille zur Besserung scheitert an den unveränderten Umständen meist schon, bevor er so richtig erwacht ist. Niemand weiß das besser als Sozialarbeiter selber, die deswegen auch jeden derartigen Erfolg mit dem Ideal ausstaffieren, so müsste man jetzt unbegrenzt weitermachen können, und mit dem Bedauern, dass das natürlich einfach nicht geht. Praktisch behält aber allemal der Standpunkt des „immerhin“ die Oberhand: Immerhin haben sie ihre Mannschaft zu Aktivitäten verleitet – nicht gerade übermäßig gesellschaftlich nützlichen, aber im gesellschaftlichen Sittlichkeitskodex wohl beleumundeten –, zu denen die Sozialfälle es von sich aus absehbarerweise nie gebracht hätten. Dass das „etwas“ ist, lässt sich nicht leugnen. Mindestens ist es Basis genug für einen Überbau an erbaulichen Deutungen, die den veranstalteten Aktivitäten einen psychologisch-sittlichen Gewinn der grundsätzlichen Art zusprechen, auch wenn kein Betroffener je davon zu berichten weiß – außer er baut es gleich so in seine persönliche Lebensideologie ein. Aber genau um die geht ja schließlich der „Kampf“!
Für die unübersehbar mageren Resultate ihrer menschlichen Aufbauarbeit haben die professionellen Betreuer im übrigen eine einfache Erklärung parat, die von ihrem unverwüstlichen Berufsstolz zeugt und die wirklichen Verhältnisse auf den Kopf stellt: Die Gesellschaft macht es ihrer Klientel einfach zu schwer, wieder ordentlich auf die Beine zu kommen, und der Staat lässt es an genügender Fürsorge fehlen, so dass die aufrichtigsten Bemühungen der Sozialarbeit fehlschlagen müssen. Auf der anderen Seite aber reißen sich auch die „Fälle“ immer nicht genügend zusammen, so dass auch nach dieser Seite der ehrenwerte Helfer seine liebe Not hat. So kann man dann ein ganzes Berufsleben mit sich und seinen humanen Anliegen zufrieden sein und den Rest der Welt, die Betreuten eingeschlossen, dafür verantwortlich machen, dass das Ergebnis alles andere als eine Änderung der Sozialstaats-Verhältnisse ist. Von wegen also „Scheitern“!
Mit Erfolgen dieser Art scheint auch der Auftraggeber der Sozialarbeit zufrieden zu sein. Auf alle Fälle müssten die zuständigen Behörden und Geldgeber glatt verzweifeln und würden ihre Zahlungen umgehend ganz einstellen, wenn sie sich vom Einsatz ihrer Sozialtruppe sichtbare praktische Effekte, womöglich eine zählbare Abnahme der auffälligen Problemfälle in ihrer Klassengesellschaft versprochen hätten. An solchen Erwartungen gemessen – die außer einigen Idealisten dieses Berufszweigs aber auch gar niemand ernsthaft hegt –, wären Sozialarbeiter noch größere Versager, als es die von ihnen betreuten Sozialfälle gemäß offizieller Betrachtungsweise und Behandlungsart sind. In Wahrheit ist der öffentliche Betreuungsauftrag bescheidener – oder luxuriöser, wie man’s nimmt.
Er ist erstens ein – und zwar aufs Ganze gesehen höchst geringfügiger – Zusatz zu den rechts-, polizei- und sozialstaatlichen Druck- und Erpressungsmitteln, mit denen eine moderne demokratische Obrigkeit ihre Klassengesellschaft nützlich macht und auch noch den nutzlosen Ausschuss im Griff behält. In Fragen der gesellschaftlichen Kontrolle lässt die nämlich nichts anbrennen und macht überhaupt nichts von dem Vertrauen abhängig, das ihre Instanzen sich bei den Bürgern erwerben. Die Vertrauenswerbung und Betreuung, die es daneben auch noch gibt und als deren bezahlte Agenten die Sozialarbeiter fungieren, ist – zweitens – ein Zusatz, der die Sortierung der Leute, die Unterscheidung nutzloser bis störender Problemfälle vom durchschnittlichen Normalfall des wunschgemäß funktionierenden nützlichen Bürgers, kräftig bestätigt, indem er sie voraussetzt. Das sozialstaatliche Urteil, welche Leute zum „lebensunwerten Leben“ gehören, ergeht in der menschenfreundlichen Form eines Hilfsangebots, das ganz einfach davon ausgeht, dass mangelhaftes Funktionieren im öffentlichen Interesse als individuelles Scheitern und höchstpersönliche Verelendungskarriere organisiert ist und auch so genommen und „bewältigt“ werden muss. „Bewältigen“ heißt dabei nicht: abstellen; so radikal ist das Hilfsangebot der Sozialarbeit nicht gemeint.
Es funktioniert vielmehr – drittens – genau umgekehrt. Die Problemfälle werden mit dem ungemütlichen Anspruch konfrontiert, sich nicht einfach in ihren trostlosen Lebensumständen einzurichten, sondern ungebrochen den guten Willen zu beweisen, sich – soweit es geht – wieder auf eigene und ordentliche Beine zu stellen. Dabei wird nicht einmal die Lüge, eine anständige Einstellung würde sich auszahlen, übermäßig gepflegt. Wie sich Schwererziehbare, Ex-Sträflinge, Drogenabhängige, Säufer und andere Fälle zu dieser moralischen Beharrung stellen, entscheidet dann sogar über den weiteren Lebensweg mit – negativ nämlich: Ohne unermüdlich vorgeführten Besserungswillen sind diese Mitglieder des marktwirtschaftlichen Ausschusses auf jeden Fall ein für alle Mal abgeschrieben. So bestätigen Sozialarbeiter auf ihre Weise die Notwendigkeit der gesellschaftlichen Sortierung, die sie korrigieren zu wollen behaupten.
Diese Einrichtung leistet also – viertens – den Sozialfällen Hilfestellung zu einem Selbstverständnis als betreutes Opfer: „gescheitert, aber vom Sozialstaat nicht im Stich gelassen“. Dieses Selbstbild meint eine soziale Demokratie offenbar noch denjenigen unter ihren Bürgern schuldig zu sein, die sie praktisch auf die unterschiedlichsten Weisen so in die Mangel nimmt, dass der normale Bürgerstolz dabei auf der Strecke bleibt. Sie führt den Beweis, dass auch diese Gesellen noch auf eine gewisse Anerkennung rechnen können; dass der Staat der ihre ist, weil er sich sogar sie noch etwas kosten lässt.
Ob die betreuten Sozialfälle ihm das abnehmen, dankbar womöglich noch, ist da nicht besonders wichtig; höchstens für den Sozialarbeiter, der diese öffentliche Grußadresse richtig zuzustellen hat. Dessen Einsatz ist aber allemal, so oder so, das demokratische Bürgerrecht des betreuten gesellschaftlichen Abfalls: dessen Recht, sich auch ohne Zwang in eine Gesellschaft ein- und einem Staatswesen unterzuordnen, in der sie sich und von dem sie sich sonst nichts weiter ausrechnen können.